Psychiatrie und Psychotherapie heute
 Psychiatrie und Psychotherapie
Psychiatrie und Psychotherapie
Depressive Störungen und Angsterkrankungen gehören zu den häufigsten psychischen Störungen. Dabei dominieren neben affektiven Symptomen wie Angst oder Depression sehr häufig Schlafstörungen, Antriebsmangel, Schmerzen und andere körperliche Beschwerden ohne organische Ursache.
Therapeutisch stehen mittlerweile zahlreiche evidenzbasierte Therapieverfahren zur Verfügung. Gemäß Leitlinienempfehlungen stellen die kognitive Verhaltenstherapie (KVT) sowie – bei mittelgradigen bis schweren Störungen – die Pharmakotherapie und deren Kombination die Strategie der Wahl dar. Dank der Entwicklungen der vergangenen
25 Jahre stehen mit den modernen Antidepressiva wie unter anderem den selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern (SSRI) und selektiven Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmern (SNRI), dem noradrenerg und spezifisch serotonerg agierenden Mirtazapin und der melatonergen Substanz Agomelatin sehr gut wirksame und verträgliche Substanzen zur Verfügung, die im ambulanten Bereich gut einsetzbar sind und sich auch bei schweren depressiven Episoden als effektiv erweisen.
Dennoch ist die Versorgung von Patientinnen/Patienten mit affektiven Störungen und Angsterkrankungen immer wieder mit Herausforderungen verbunden. Zu den wichtigsten Aspekten zählen dabei unter anderem (a) das Management therapieresistenter Verläufe, (b) die Verfügbarkeit von Psychotherapie sowie (c) die Beendigung einer pharmakologischen Therapie, weswegen sich der vorliegende Beitrag neuen Entwicklungen und Erkenntnissen dieser Fragen widmet.
Kasuistik 1
Therapieresistente Depression: Neue Perspektiven durch Antagonismus am NMDA-Rezeptor
Ein 47-jähriger Mechaniker stellte sich in der psychiatrischen Ambulanz mit einer seit mehreren Jahren bestehenden rezidivierenden depressiven Störung mit im Vordergrund stehendem Antriebsmangel und depressivem Affekt (ICD-10: F33.2) vor. In den vergangenen zwei Jahren persistierten die depressiven Symptome trotz mehrerer leitliniengerechter Therapieansätze. Neben Antriebslosigkeit imponierten Schlafstörungen, Interessenverlust sowie immer wieder auch Suizidgedanken ohne akuten Handlungsdruck. Der Patient war bereits seit längerem arbeitsunfähig und sozial weitgehend isoliert. In der Vorgeschichte lagen multiple pharmakologische Therapieversuche mit SSRI (Sertralin, Escitalopram), einem selektiven Noradrenalin- und Dopamin-Wiederaufnahmehemmer (Bupropion), einem trizyklischen Antidepressivum (Amitriptylin) sowie eine Augmentation mit Lithium und Quetiapin vor – jeweils ohne ausreichenden Erfolg. Eine vom behandelnden Psychiater ins Gespräch gebrachte Elektrokonvulsionstherapie lehnte der Patient ab. Psychotherapeutische Maßnahmen (tiefenpsychologisch fundierte Therapie, später Verhaltenstherapie) wurden über mehrere Jahre ohne signifikante Besserung durchgeführt. Zuletzt war der Patient auf Venlafaxin 225 mg/d eingestellt, ebenfalls ohne nennenswerten Erfolg. In Anbetracht des nunmehr therapieresistenten Verlaufs wurde bei dem Patienten ergänzend zum bestehenden SNRI eine Therapie mit intranasalem Esketamin begonnen, zunächst 56 mg, später 84 mg. Bereits nach den ersten Anwendungen zeigte sich innerhalb weniger Stunden eine spürbare Besserung der affektiven Symptomatik. Der Patient beschrieb eine „plötzliche Aufhellung“ seiner Gedanken und einen Rückgang der suizidalen Impulse. Nach etwa vier Wochen regelmäßiger Applikation (2 ×/Woche) stabilisierte sich der Zustand deutlich. Der Patient war wieder in der Lage, alltägliche Aufgaben zu bewältigen und nahm Kontakt zu Freunden auf. Nebenwirkungen wie Schwindel, Dissoziation und Übelkeit traten initial zwar auf, waren aber insgesamt für den Patienten gering ausgeprägt, damit gut tolerierbar und zunehmend rückläufig. Die MADRS-Skala zur Erfassung des Schweregrad einer Depression zeigte eine Reduktion von 35 auf 15 Punkte und damit eine Reduktion des ursprünglich als schwer einzustufenden depressiven Syndroms auf das Niveau einer leichten depressiven Symptomatik. Nach etwa drei Monaten zeigte sich eine stabile partielle Remission. Die Esketaminfrequenz wurde sukzessive reduziert (zunächst 1 ×/Woche, dann 1 ×/14 Tage). Eine begleitende Verhaltenstherapie wurde ebenso wie die Medikation mit Venlafaxin fortgeführt.
Kommentar
Die therapieresistente Depression (TRD) ist charakterisiert durch fehlendes Ansprechen auf mindestens zwei Antidepressiva trotz adäquater Dosis, Behandlungsdauer und Therapietreue. Schätzungen zufolge weisen bis zu 30 Prozent der Patienten mit depressiven Erkrankungen
einen therapieresistenten Verlauf auf. Erheblicher Leidensdruck sowie ein erhöhtes Suizidrisiko sind die Folge [1]. Neben pharmakologischen Strategien wie der Umstellung des Antidepressivums auf eine Substanz mit anderem Wirkprinzip (zum Beispiel von SSRI auf SNRI, von SNRI auf Bupropion oder Mirtazapin oder MAO-Hemmer), einer Kombination von sich psychopharmakologisch sinnvoll ergänzenden Substanzen (zum Beispiel SNRI + Mirtazapin) oder einer Augmentation mit Lithium oder Quetiapin stellt insbesondere die Elektrokonvulsionstherapie (EKT) das Verfahren der Wahl für das Management therapieresistenter Verläufe dar. Bei letzterer handelt es sich um das nach wie vor wirksamste antidepressive Verfahren, das insbesondere auch bei wahnhafter Depression eine besondere Effektivität aufweist [2]. Unter den innovativen medikamentösen Therapieoptionen stellt Esketamin als S-Enantiomer von Ketamin einen neuartigen Ansatz für die Behandlung therapieresistenter Depressionen dar. Der Wirkmechanismus basiert auf dem Antagonismus von N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptoren (NMDA-R) und damit auf einer direkten Beeinflussung des glutamatergen Systems [3]. In Deutschland ist Esketamin unter anderem für die Behandlung therapieresistenter depressiver Episoden in Kombination mit einem SSRI oder SNRI zugelassen. Die Anwendung erfolgt intranasal über ein Dosierspray in Dosen von 28 mg, 56 mg oder 84 mg, wobei die initiale Therapie typischerweise zweimal pro Woche unter Aufsicht von medizinischem Fachpersonal durchgeführt wird. Im weiteren Verlauf wird die Frequenz schrittweise reduziert, um eine Erhaltungstherapie zu ermöglichen. Die klinische Evidenz zeigt, dass Esketamin rasch, meist innerhalb von Stunden bis wenigen Tagen, eine Reduktion depressiver Symptome bewirken kann [4].
Das Wichtigste in Kürze
Eine gezielte Modulation der glutamatergen Neurotransmission durch Angriff am NMDA-Rezeptor stellt eine neue und hochwirksame Therapiestrategie bei schweren und therapieresistenten depressiven Erkrankungen dar. Hervorzuheben sind die einfache Applikation sowie der vergleichsweise rasche Wirkeintritt, angesichts dessen von einer neuen Klasse sogenannter „Fast-Acting-Antidepressants“ gesprochen wird.
Nebenwirkungen: Schwindel, Sehstörungen, Erhöhter Blutdruck, Übelkeit, Kopfschmerzen, Dissoziation
Kontraindikationen: Nicht für Patienten geeignet mit klinisch signifikanten oder instabilen kardiovaskulären Erkrankungen oder wenn erhöhter Blutdruck oder erhöhter intrakranieller Druck ein schwerwiegendes Risiko darstellt, zum Beispiel bei anamnestisch bekannten Aneurysmata oder intrazerebralen Blutungen etc.
Kasuistik 2
Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) zur Überbrückung und Ergänzung bei psychischenErkrankungen
Eine 34-jährige Bürokauffrau stellte sich in der Hausarztpraxis mit anhaltenden Symptomen einer generalisierten Angststörung (ICD-10: F41.1) vor. Seit über zwei Jahren litt sie unter übermäßigen Sorgen, muskulärer Anspannung, innerer Unruhe und Einschlafstörungen. Die Angst betraf verschiedenste Lebensbereiche, insbesondere ihre berufliche Leistungsfähigkeit sowie die Gesundheit nahestehender Personen. Begleitend zeigten sich somatische Beschwerden wie Herzrasen, gastrointestinale Beschwerden und Spannungskopfschmerzen. In der Anamnese fanden sich keine Hinweise auf Substanzmissbrauch oder gravierende psychosoziale Belastungsfaktoren, jedoch eine familiäre Disposition zu Angststörungen. Körperliche Erkrankungen lagen ebenfalls nicht vor. Nach diagnostischer Abklärung und Fragebogenerhebung wurde die Diagnose einer generalisierten Angststörung gestellt (GAD-7: Gemessen wird die Angstsymptomatik innerhalb der letzten zwei Wochen mittels eines kurzen Fragebogens. Leichte Symptome: 0-4, milde Symptome: 5-9, moderate Symptome 10-14 und schwere Symptome > 15). Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit ambulanter Psychotherapieplätze und der ausgeprägten Eigenmotivation wurde der Patientin ein Therapieversuch mittels digitaler Gesundheitsanwendung (DiGA) als Übergangs- bzw. unterstützende Maßnahme empfohlen. Die Wahl fiel auf eine von den gesetzlichen Krankenkassen zugelassene kognitive Verhaltenstherapie-basierte DiGA mit Schwerpunkt auf Exposition, kognitiver Umstrukturierung und Achtsamkeitstechniken. Die Anwendung beinhaltete psychoedukative Module, tägliche Übungen zur Emotionsregulation, digitale Tagebuchfunktionen und wöchentliche Reflexionseinheiten mit Feedback durch eine integrierte KI-gestützte Analyse. Ergänzend fanden monatliche Kontrolltermine in der Praxis statt. Bereits nach vier Wochen berichtete die Patientin über eine signifikante Reduktion der körperlichen Anspannung sowie eine verbesserte Schlafqualität. Die regelmäßige Anwendung der Atem- und Achtsamkeitsübungen im Alltag wurde als besonders hilfreich erlebt. Im weiteren Verlauf zeigte sich eine zunehmende Fähigkeit zur kognitiven Distanzierung von angstauslösenden Gedanken. Bei der Abschlussbewertung nach acht Wochen konnte ein Rückgang des GAD-7-Scores auf 7 Punkte festgestellt werden, was einer leichten Ausprägung der Symptomatik entspricht. Subjektiv beschrieb die Patientin eine gesteigerte Selbstwirksamkeit und ein besseres Verständnis für die Mechanismen ihrer Angstsymptomatik. Nach zwölf Wochen konnte die Patientin schließlich regulär in eine ambulante Verhaltenstherapie überführt werden, wobei die zuvor mit der DiGA erlernten Strategien nahtlos in die weitere Therapie integriert wurden.
Kommentar
Digitale Therapieangebote rücken gerade in der Versorgung von psychischen Erkrankungen zunehmend in den Fokus [5]. Grundlage ist das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG), das seit 2020 die Integration geprüfter digitaler Lösungen in die Regelversorgung ermöglicht. Nach positiver Bewertung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) werden DiGA in das Verzeichnis erstattungsfähiger Anwendungen aufgenommen und von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert. Mehr als die Hälfte aller DiGA wurden zum Einsatz bei psychischen Erkrankungen entwickelt. Für Angsterkrankungen, insbesondere für die Panikstörung, die generalisierte Angststörung und die soziale Phobie stehen derzeit (Stand: Oktober 2025), insgesamt sechs dauerhaft zugelassene Anwendungen zur Verfügung. Diese können im DiGA-Verzeichnis des BfArM abgerufen werden (https://diga.bfarm.de/de).
Die Verordnung erfolgt durch den Arzt auf Rezept unter Angabe der Pharmazentralnummer (PZN) und des Namens der App. Der Patient reicht das Rezept bei seiner Krankenkasse ein und erhält in der Folge von dieser einen Freischaltcode.
DiGA zählen in der internationalen wissenschaftlichen Literatur zu den sogenannten Selbstmanagement-Interventionen und haben sich sowohl für Angst als auch für Depressionen in Studien und Metaanalysen als wirksam erwiesen [6].
Für die in Deutschland verfügbaren Anwendungen ist die Datenlage für einige Anwendungen mittlerweile ebenfalls als gut zu bewerten [7]. Allerdings ersetzt die DiGA weder die Ärztin/den Arzt noch die Psychotherapeutin/den Psychotherapeuten. Vielmehr sollten DiGA idealerweise in einem Blended-Care-Ansatz in den Gesamtbehandlungsplan integriert werden. Dabei kommt die DiGA entweder begleitend oder intermittierend parallel zu einer laufenden Behandlung, zur Überbrückung bis zur Erlangung eines Therapieplatzes oder zur Nachsorge zum Einsatz [8].
Das Wichtigste in Kürze
Zusammengefasst erweisen sich DiGA – integriert in ein Gesamtbehandlungskonzept – geeignet als sinnvolle Ergänzung im Sinne einer Überbrückung, Begleitung oder Nachsorge einer Behandlung psychischer Erkrankungen.
Kasuistik 3
Erfolgreiches Absetzen eines Antidepressivums nach remittierter depressiver Episode
Ein 42-jähriger Gymnasiallehrer stellte sich in der psychiatrischen Fachambulanz zur Verlaufskontrolle einer seit 18 Monaten remittierten mittelgradigen depressiven Episode vor. Im Vordergrund standen zu Beginn der Episode insbesondere eine ausgeprägte Antriebsarmut sowie zahlreiche berufsbezogene Ängste und Sorgen. Die Behandlung erfolgte mit dem SSRI Sertralin 100 mg täglich in Kombination mit kognitiver Verhaltenstherapie. Die depressive Symptomatik hatte sich unter dieser Therapie im Verlauf deutlich gebessert. Seit über einem Jahr zeigte der mittlerweile vollständig remittierte Patient eine stabile Stimmungslage, ein Abklingen irrationaler Ängste sowie eine vollständige soziale und berufliche Reintegration. Nach ausführlicher Aufklärung wurde gemeinsam mit dem Patienten die Beendigung der medikamentösen Behandlung besprochen. Es wurde ein individueller Reduktionsplan erstellt, der eine schrittweise Dosisreduktion über zwölf Wochen vorsah. Im ersten Schritt wurde die Dosis auf 75 mg reduziert. Eine wöchentliche Kontrolle des psychopathologischen Zustands zeigte keine affektiven Schwankungen. Nach weiteren drei Wochen erfolgte die Reduktion auf 50 mg, ebenfalls ohne relevante Nebenwirkungen oder Verschlechterung der Symptomatik. Die engmaschige psychotherapeutische Begleitung wurde beibehalten. In Woche 8 erfolgte die Reduktion auf 25 mg, gefolgt vom kompletten Absetzen in Woche 12. Während und nach dem Ausschleichen wurden regelmäßig PHQ-9-Fragebögen erhoben, welche konstant niedrige Werte zeigten (PHQ9: Screening Instrument zur Erfassung einer Depression: 0-4: minimale Symptome, 5-9: milde Symptome, 10-14: leichte depressive Symptomatik, 15-19: mittelgradige Depression, 20-27: schwere depressive Symptomatik). Regelmäßige ambulante Nachsorgetermine wurden vereinbart. Sechs Monate nach vollständigem Absetzen des Antidepressivums war der Patient weiterhin symptomfrei, psychisch stabil und sozial integriert.
Kommentar
Das erfolgreiche Absetzen einer antidepressiven Medikation gehört zu den besonderen Herausforderungen in der Behandlung depressiver Erkrankungen. Dabei ist wichtig zu wissen, dass zum Erhalt einer stabilen Remission die antidepressive Therapie auch nach vollständigem Abklingen aller Symptome zunächst noch weitergeführt werden muss. Die Dauer der Rezidivprophylaxe richtet sich dabei unter anderem nach der Anamnese: Handelt es sich um die erste Episode, wird ein Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten empfohlen [9]. Bei Patienten, die in ihrem Leben schon mehrere depressive Episoden erlitten haben, empfiehlt es sich, die Erhaltungstherapie über mehrere Jahre fortzusetzen, im Einzelfall, zum Beispiel bei schweren und jahrzehntelangen Verläufen, ist eine lebenslange Prophylaxe notwendig. Ist die Entscheidung für das Absetzen gefallen, sollte die Reduktion des Antidepressivums schrittweise erfolgen, idealerweise über einen Zeitraum von acht bis zwölf Wochen [9]. Eine Fortführung ambulanter Kontrolltermine sowie der psychotherapeutischen Behandlung ist während dieses Zeitraums wichtig. Werden die genannten Aspekte berücksichtigt, ist das Auftreten von sogenannten Absetzsymptomen wie zum Beispiel Schwindel oder Unruhe nicht zu erwarten. Sollte es im Verlauf dennoch zu einer Verschlechterung kommen, lassen sich die Beschwerden in der Regel durch die Wiederaufnahme der zuletzt verordneten Dosis und ein langsameres Ausschleichen gut beherrschen.
Eine häufige, aber unbegründete Befürchtung im Zusammenhang mit der Anwendung von Antidepressiva ist die Entwicklung eines Abhängigkeitssyndroms. Hier ist hervorzuheben, dass Antidepressiva grundsätzlich kein Abhängigkeitsrisiko bergen. So lassen sich zentrale Abhängigkeitskriterien, wie zum Beispiel Toleranzentwicklung, Kontrollverlust, Craving, Beschaffungsaufwand sowie fortgesetzter Konsum trotz Folgeschäden für Antidepressiva nicht nachweisen. Allerdings kann es vor allem bei abruptem Absetzen zu sogenannten Absetzsymptomen kommen. Hierzu zählen unter anderem Unruhe, Schwitzen, Schwindel, Übelkeit, Schlafstörungen sowie eine allgemeine Symptomverschlechterung. Die Häufigkeit solcher Absetzsymptome nach Absetzen von Antidepressiva wurde kürzlich in einer Metaanalyse von Henssler et al. (2024) untersucht. Die Auswertung von 79 Studien mit über 20.000 Patienten zeigte, dass 31 Prozent der Patienten, die ein Antidepressivum eingenommen hatten, mindestens ein Absetzsymptom berichteten, während dies bei 17 Prozent der Patienten nach Absetzen von Placebo der Fall war. Nach Abzug der Absetzsymptome nach Placeboeinnahme und Adjustierung entsprechend den unterschiedlichen Stichprobengrößen, kann in etwa 15 Prozent der Fälle von leichten und vorübergehenden Absetzsymptomen bei Antidepressiva ausgegangen werden. Schwere Absetzsymptome traten bei etwa drei Prozent in der Antidepressiva-Gruppe (vs. 0,6 Prozent nach Placebo) und somit vergleichsweise selten auf [10]. Grundsätzlich kann dem Auftreten von Absetzsymptomen durch eine gute Begleitung und langsames Ausschleichen des Medikaments über einen Zeitraum von zwei bis drei Monaten entgegengewirkt werden, weswegen diesem Aspekt in der Nachsorge besondere Bedeutung zukommt.
Das Wichtigste in Kürze
Zusammengefasst kann dem vielgehegten Wunsch von Patienten nach dem Absetzen einer antidepressiven Medikation entsprochen werden, wenn die gemäß Leitlinien empfohlene Dauer der Rezidivprophylaxe eingehalten wurde. Wird der Prozess des Absetzens fachgerecht, das heißt in mehreren Schritten über einen längeren Zeitraum und ärztlich begleitet, durchgeführt, sind Absetzsymptome in der Regel selten.
Die Autoren erklären, dass sie keine finanziellen oder persönlichen Beziehungen zu Dritten haben, deren Interessen vom Manuskript positiv oder negativ betroffen sein könnten.
Das Literaturverzeichnis kann im Internet unter www.bayerisches-aerzteblatt.de (Aktuelles Heft) abgerufen werden.
Autoren
Professor Dr. Peter Zwanzger
Ärztlicher Direktor
Chefarzt Fachbereich Psychosomatik
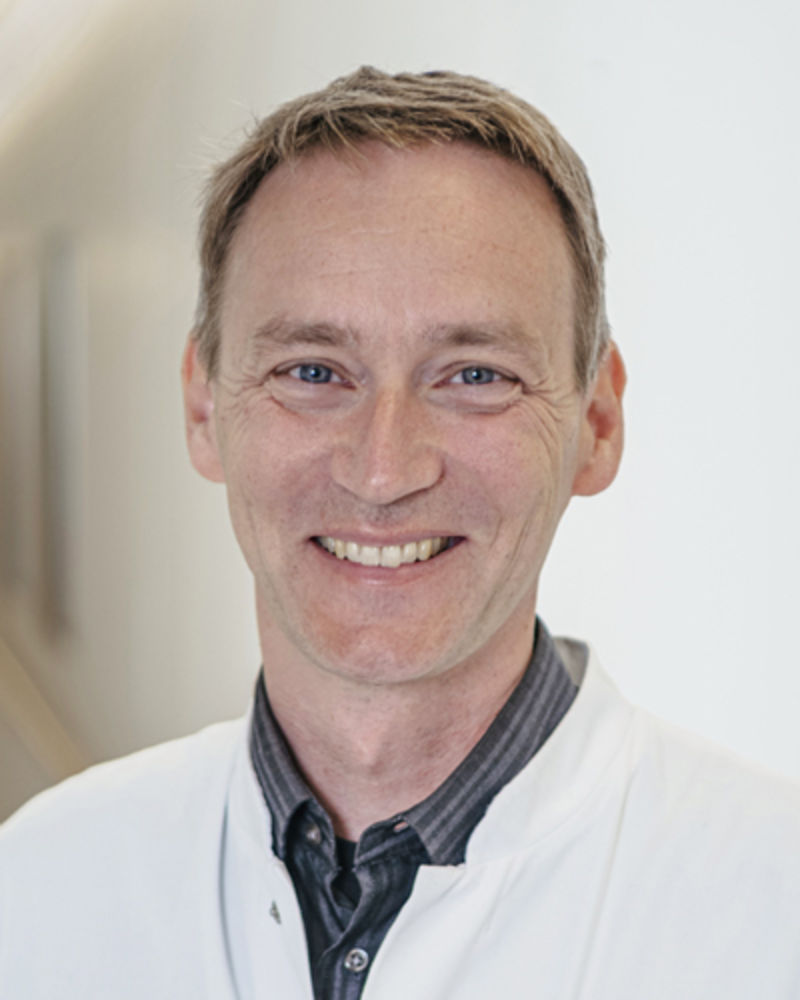
Dr. Niels-Christian Köstner
Chefarzt Bereich Allgemeinpsychiatrie
und Aufnahmemanagement
kbo-Inn-Salzach-Klinikum, Akademisches Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität München, Gabersee 7, 83512 Wasserburg am Inn
Teilen:
Das könnte Sie auch interessieren:






