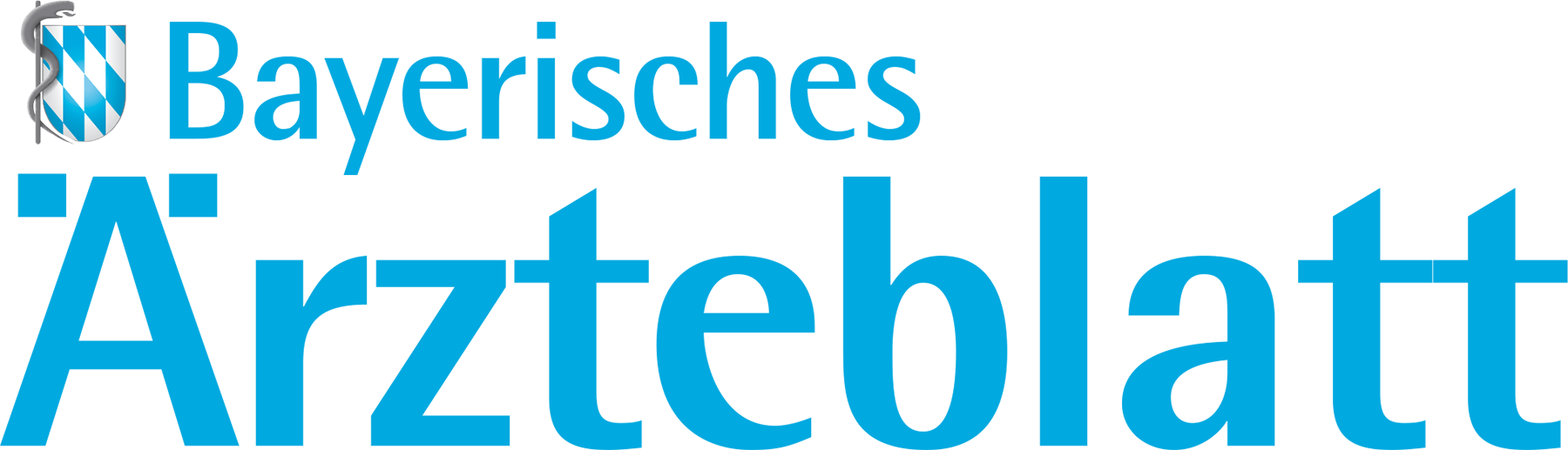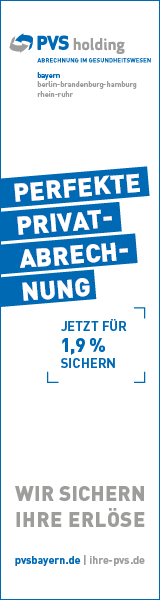Reformvorschläge mit Potenzial
 Dr. Gerald Quitterer
Dr. Gerald Quitterer
„Verantwortung für Deutschland“ – so lautet der Titel des Koalitionsvertrags zwischen CDU/CSU und SPD, der Anfang April veröffentlicht wurde. Darin werden die Ziele definiert, die während der gemeinsamen Regierungszeit verwirklicht werden sollen. Welche Veränderungen für uns Ärztinnen und Ärzte planen die drei Parteien? Und wie könnten diese Maßnahmen die medizinische Versorgung in Deutschland beeinflussen? Im Fokus stehen Vorhaben wie die gesetzliche Regulierung investorenbetriebener Medizinischer Versorgungszentren (iMVZ), eine stärkere Patientensteuerung angesichts des steigenden Kostendrucks, sowie der Abbau bürokratischer Hürden.
Der Konsens, „zu einer möglichst zielgerichteten Versorgung der Patientinnen und Patienten und für eine schnellere Terminvergabe auf ein verbindliches Primärarztsystem bei freier Arztwahl durch Haus- und Kinderärzte in der Hausarztzentrierten Versorgung und im Kollektivvertrag“ zu setzen, sowie für „Patientinnen und Patienten mit einer spezifischen schweren chronischen Erkrankung geeignete Lösungen“ zu erarbeiten, folgt dem Antrag des Deutschen Ärztetages von 2024 und erwartungsgemäß wird auf dem diesjährigen Deutschen Ärztetag vom Vorstand der Bundesärztekammer ein Konzept zur Koordination und Orientierung in der Versorgung vorgelegt werden.
Geht es doch um nichts weniger, als in einer Zeit, in der Ärztinnen und Ärzte wie auch andere Gesundheitsfachberufe an der Belastungsgrenze und oft darüber hinaus arbeiten, die vorhandenen Versorgungskapazitäten stärker als bisher zielgerichtet einzusetzen. Eine solche Reform könnte das Personal in den fachärztlichen Praxen entlasten, den Zugang zu Fachärztinnen und Fachärzten bedarfsgerechter und strukturierter gestalten sowie Wartezeiten verkürzen. Die dabei angedachte Prüfung der Entbudgetierung von Fachärztinnen und Fachärzten wäre ein wichtiger Schritt zur Stärkung der ambulanten Versorgung. Es darf jedoch nicht nur bei einer Prüfung bleiben, sondern bedarf der konsequenten Umsetzung, der weitere Schritte in Richtung einer vollständigen Entbudgetierung fachärztlicher Leistungen folgen müssen.
Die in diesem Zusammenhang stereotyp geführte Diskussion der rascheren Terminvergabe für Privatpatientinnen und -patienten und jüngst vom Medizinischen Dienst über das Angebot an individuellen Gesundheitsleistungen stellt eine nicht sachgerechte Einmischung in unsere ärztliche Berufsfreiheit dar und sollte auch nur von denjenigen geführt werden, die selbst in der Versorgung tätig sind.
Was fehlt, ist eine konsequente Steuerung der Inanspruchnahme von Notaufnahmen in Kliniken durch eine vorgelagerte validierte strukturierte medizinische Ersteinschätzung, die Patientinnen und Patienten unter Berücksichtigung der Dringlichkeit verbindlich in die adäquate Versorgungsebene leitet.
Im Koalitionsvertrag ist vorgesehen, die Kompetenz der Gesundheitsberufe in der Praxis zu stärken. Dieser Satz hört sich gut an, darf aber nicht nur ein Lippenbekenntnis bleiben. Entscheidend ist, ob mit dieser Formulierung künftig auch tatsächlich die Medizinischen Fachangestellten, die seit Jahren die Versorgung mit uns in der Teampraxis gestalten, ins Blickfeld der Politik gerückt werden, wenn an anderer Stelle die Formulierung zu lesen ist: „Kurzfristig bringen wir Gesetze zur Pflegekompetenz, Pflegeassistenz und zur Einführung der ‚Advanced Practice Nurse‘ auf den Weg und sichern den sogenannten ‚kleinen Versorgungsvertrag‘ rechtlich ab“ und weiter: „Wir erhöhen die Wertschätzung und Attraktivität der Gesundheitsberufe. Wir ermöglichen den kompetenzorientierten Fachpersonaleinsatz und die eigenständige Heilkundeausübung“. Ist das also des Pudels Kern? Wieder einmal die Heilkundeübertragung an nichtärztliche Fachberufe statt die bisher kompetent versorgenden Praxisteams in den Mittelpunkt der Überlegungen zu stellen.
Profitieren könnte der ambulante Sektor auch von den Plänen, endlich ein Gesetz zur Regulierung von iMVZ zu verabschieden. Wie bereits mehrfach in Ärztetagsanträgen formuliert, ist dabei zu fordern, dass MVZ künftig nur noch dann gegründet werden dürfen, wenn sich die Mehrheit der Gesellschaftsanteile und Stimmrechte der MVZ-Trägergesellschaft in Händen von Ärztinnen und Ärzten befindet. Zudem sind Aufgaben und Verantwortungsbereich des ärztlichen Leiters eines MVZ zu konkretisieren. Ähnlich wie bei Vertragsärztinnen und -ärzten sollte auch eine Eignungsprüfung für MVZ eingeführt werden dahingehend, ob zulassungswillige MVZ eine ordnungsgemäße vertragsärztliche Versorgung gewährleisten können.
Bei der Krankenhausreform wollen Union und SPD richtigerweise auf mehr Pragmatismus setzen, etwa durch notwendige Anpassungen bei der Zuweisung von Leistungsgruppen im Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG). Das darf jedoch nicht dazu führen, dass beispielsweise Leistungsgruppen in der kinderärztlichen Schwerpunktversorgung gestrichen werden und damit dieser spezialisierte Bereich im stationären Setting nicht mehr zur Verfügung steht. Sinnvoll ist zudem, die Transformation der finanziell gebeutelten Krankenhäuser durch Gelder aus dem Sondervermögen Infrastruktur zu unterstützen: „Die Lücke bei den Sofort-Transformationskosten aus den Jahren 2022 und 2023 sowie den bisher für die GKV vorgesehenen Anteil für den Transformationsfonds für Krankenhäuser finanzieren wir aus dem Sondervermögen Infrastruktur“, schreiben Union und SPD. Die ursprüngliche Idee, diese Milliarden-Investitionen den Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern aufzubürden, war wenig durchdacht.
Kritisch sehe ich allerdings, dass die Kopplung der Vorhaltefinanzierung an das Fallpauschalen-System beibehalten werden soll. Das Problem der Finanzierung ist aktuell nicht gelöst und der Leistungsgruppen-Grouper an Komplexität nicht zu überbieten. Der bürokratische Aufwand droht die intendierte Steuerung zu konterkarieren und damit mehr Schaden als Nutzen für die Versorgung zu bewirken. Nicht aus den Augen verloren werden dürfen zudem im Zusammenhang mit dieser Reform die Folgen für die Weiterbildung, bedeutet die Zuweisung von definierten Leistungsgruppen doch unter Umständen, dass in einzelnen Kliniken die bisherigen Weiterbildungsbefugnisse überprüft und gegebenenfalls angepasst werden müssten. Brauchen wir also nicht besser ein Moratorium der Reform, bis die zahlreichen Kritikpunkte aufgearbeitet sind? Zudem gilt es, die in diesem Gesetz avisierte sektorenverbindende Versorgung nachhaltig zu stärken.
Enorm wichtig ist folglich das angekündigte Bürokratieentlastungsgesetz, das darauf abzielt, die ausufernden Dokumentationspflichten und Kontrolldichten im Gesundheitswesen zu reduzieren. Nach den Erfahrungen aus der vergangenen Legislaturperiode, in der die Politik über bloße Absichtserklärungen nicht hinauskam, ist ein solches Gesetz dringend notwendig. Allein im ärztlichen Dienst der Krankenhäuser summiert sich der Zeitaufwand für administrative Tätigkeiten im Mittel auf rund drei Stunden täglich (Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts 2024). Im ambulanten Bereich sind wir bei über 55 Millionen Nettoarbeitsstunden (www.kbv.de/html/bix.php) für bürokratischen Aufwand jährlich, was letztlich zu längeren Wartezeiten nicht nur bei der Terminvergabe, sondern auch in der Patientenbehandlung führt. Wen mag da verwundern, dass in den vergangenen Wochen dieser Zustand von verschiedenen Medien prompt als volkswirtschaftlich schädlich eingestuft wurde.
Es ist darüber hinaus ein positives Signal, dass Union und SPD die Gesundheitsförderung sowie die (Sucht-)Prävention stärken möchten – beispielsweise durch eine Erweiterung der Vorsorgeuntersuchungen im Kindes- und Jugendalter. Gleichzeitig halte ich es für wichtig, dass die künftige Regierung strengere Vorschriften gegen Werbung für gesundheitsschädigende Produkte, insbesondere für extrem zucker- und fetthaltige Lebensmittel, erlassen, Herstellerabgaben auf gesüßte Getränke und höhere Steuern auf Alkohol, Tabak- und Nikotinprodukte einführen. Die erzielten Mehreinnahmen könnten gezielt in Präventionsmaßnahmen investiert werden.
Der Klimaschutz wird im Koalitionsvertrag aus meiner Sicht nicht ausreichend genug berücksichtigt. Verantwortung für Deutschland zu übernehmen bedeutet auch, diesem Thema eine hohe Priorität einzuräumen. Definierte Klimaziele gilt es einzuhalten, wenn wir die gesundheitlichen Folgen der Erderwärmung, die heute schon zu spüren sind, im Griff halten wollen. Dazu gehört in erster Linie die Energiewende, die kürzlich von Professor Dr. Harald Lesch, Fakultät für Physik der LMU München und Dr. Martin Herrmann, Vorsitzender Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit, als größtes Gesundheitsprojekt unserer Zeit bezeichnet wurde.
Zu guter Letzt: Um im Krisenfall Handlungsfähigkeit zu bewahren, braucht es einen umfassenden zivilen Operationsplan für das deutsche Gesundheitswesen. Zielsetzung muss es sein, durch Aktualisierung bestehender Krisen- und Katastrophenpläne unter Beteiligung der ärztlichen Expertise den ambulanten und stationären Versorgungssektor mit einzubinden.
Teilen:
Das könnte Sie auch interessieren: