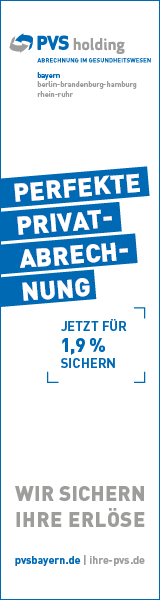Interview mit Professor Dr. Philipp Sprengholz zum Projekt „Heatcom“
Wann entwickeln Menschen ein Bewusstsein für die gesundheitlichen Gefahren von Hitze? Und welche Voraussetzungen sind notwendig, damit sie Schutzmaßnahmen ergreifen? Das sind einige der Fragen, die von der Otto-Friedrich-Universität Bamberg und der Universität Erfurt seit 2023 im Projekt „Heatcom“ untersucht werden, das vom Bundesministerium für Gesundheit gefördert wird. Im Kurzinterview mit dem „Bayerischen Ärzteblatt“ stellt Professor Dr. Philipp Sprengholz, Projektleiter und Juniorprofessor für Gesundheitspsychologie an der Universität Bamberg, die Ziele und ersten Ergebnisse des Projekts vor und erläutert, welche Maßnahmen er sich von der Politik wünscht, um die Hitzeprävention voranzubringen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf einer Studie zum Hitzeerleben und -verhalten wohnungsloser Menschen.
Das Projekt „Heatcom“ basiert auf mehreren Teilprojekten. Was wird im Rahmen der einzelnen Teilprojekte untersucht und welche Ziele werden dabei verfolgt?
Das vom Bundesministerium für Gesundheit geförderte Kooperationsprojekt der Universitäten Bamberg und Erfurt untersucht das Hitzeerleben und -verhalten in Deutschland. Wir wollen herausfinden, wie sich Menschen bei Hitze verhalten und was verändert werden muss, damit sie sich besser vor hohen Temperaturen schützen können. Während sich die Erfurter Kolleginnen und Kollegen mit der breiten Bevölkerung beschäftigen, richtet sich unser Fokus auf den Hitzeschutz besonders vulnerabler Gruppen. Dazu gehören beispielsweise ältere Personen, Wohnungslose, aber auch Personen, die in Hitzewellen im Freien arbeiten oder Sport treiben. Wir untersuchen, wie diese Personen das Risiko durch hohe Temperaturen wahrnehmen, ob und wie sie ihren Alltag an Hitzewellen anpassen und welche Veränderungen in der Gesundheitsversorgung oder Stadtplanung nötig sind, um den Hitzeschutz zu verbessern. Beispielsweise versuchen wir herauszufinden, ob Medikamente in Hitzewellen korrekt gelagert und dosiert werden, über welche Kanäle Hitzewarnungen am besten gestreut werden können oder wie die Nutzung von Trinkbrunnen in Innenstädten verbessert werden kann. Dabei arbeiten wir vor allem mit Umfragen in den vulnerablen Gruppen selbst, es werden aber auch wichtige Kontaktpunkte wie Pflegekräfte und Ärztinnen und Ärzte in die Forschung eingebunden.
Was sind bisher die wichtigsten Ergebnisse?
Wir stehen noch am Anfang des Projektes, die ersten Ergebnisse zeigen aber, dass sowohl psychologische als auch strukturelle Barrieren einen effektiven Hitzeschutz erschweren. Hitze wird in vielen vulnerablen Gruppen unterschätzt, häufig wird das Gesundheitsrisiko erst erkannt, wenn Symptome einer Hitzeerkrankung auftreten. Während viele Menschen Kleidung und Ernährung im Sommer anpassen und ihre Wohnung durch Verdunkelung oder strategisches Lüften kühl halten, wird die Dosierung und Lagerung von Medikamenten nur selten an heiße Temperaturen angepasst. Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit von zielgruppenspezifischen Informationskampagnen. Gleichzeitig müssen die Umweltbedingungen verbessert werden. Unsere Forschung zeigt dies eindrücklich am Beispiel wohnungsloser Menschen.
Wie könnten wohnungslose Menschen besser vor Hitze geschützt werden?
Selbst wenn wohnungslose Menschen die Gefahren heißer Temperaturen richtig einschätzen, können sie sich kaum dagegen schützen. Wir haben im vergangenen Sommer über 250 wohnungslose Menschen in ganz Deutschland nach ihrem Verhalten in Hitzewellen befragt. Es zeigte sich, dass die Betroffenen an heißen Tagen explizit kühle Orte wie Bahnhöfe, Einkaufszentren oder öffentliche Gebäude aufsuchen, von dort aber häufig vertrieben werden. Schattenplätze in Innenstädten sind rar und bleiben diesen Menschen oft verwehrt. Das Problem gesellschaftlicher Ausgrenzung zeigte sich auch bei der Wasserversorgung. Zwar berichteten viele Befragte von funktionierenden Trinkbrunnen und Getränkeangeboten der Wohnungslosenhilfe, jedoch begrenzten sie die Wasseraufnahme an heißen Tagen oft auf ein Minimum, um Wege zu den kaum vorhandenen und weit entfernten öffentlichen Toiletten zu reduzieren. Kurzfristig müssen mehr kühle Aufenthaltsorte für wohnungslose Menschen bereitgestellt und das Netz an öffentlichen Toiletten ausgebaut werden. Langfristig ist den Betroffenen natürlich vor allem mit einem besseren Angebot an bezahlbarem und adäquatem Wohnraum geholfen, eine wichtige Maßnahme, die neben Hitze auch viele andere Gesundheitsrisiken reduziert.
Welche Maßnahmen würden Sie sich von der Politik wünschen, um die Hitzeprävention voranzubringen?
Durch unsere Arbeit sind wir mit vielen Kommunen und sozialen Trägern im Austausch und sehen, dass im Kleinen schon sehr viel für den Hitzeschutz getan wird. Allerdings passen die regulatorischen Rahmenbedingungen oft noch nicht. Zum Beispiel zeigt unsere Forschung, dass ambulant gepflegte Senioren den größten Teil ihrer Zeit in der eigenen Wohnung verbringen, diese aber nur selten durch technische Maßnahmen wie Außenrolläden, Hitzeschutzfolien oder Klimaanlagen hitzeertüchtigt ist. Eine wesentliche Hürde stellen fehlende finanzielle Mittel für die Beschaffung und Installation der Technik dar. Eine aus meiner Sicht einfache Möglichkeit zur Lösung des Problems wäre die Anerkennung der Hitzeertüchtigung als wohnumfeldverbessernde Maßnahme. Nach dem Sozialgesetzbuch kann die Pflegeversicherung für solche Maßnahmen über 4.000 Euro bereitstellen, genug um beispielsweise eine Klimaanlage zu installieren. Mehr Pragmatismus und politisches Engagement würde ich mir auch bei der Förderung und Umsetzung von Hitzeschutzmaßnahmen für wohnungslose Menschen wünschen, die in unserer Gesellschaft oft nur wenig Gehör finden, auf eine vor Hitze schützende urbane Infrastruktur mit Schattenplätzen, Trinkbrunnen und öffentlichen Toiletten aber besonders angewiesen sind.
Die Fragen stellte Florian Wagle (BLÄK)

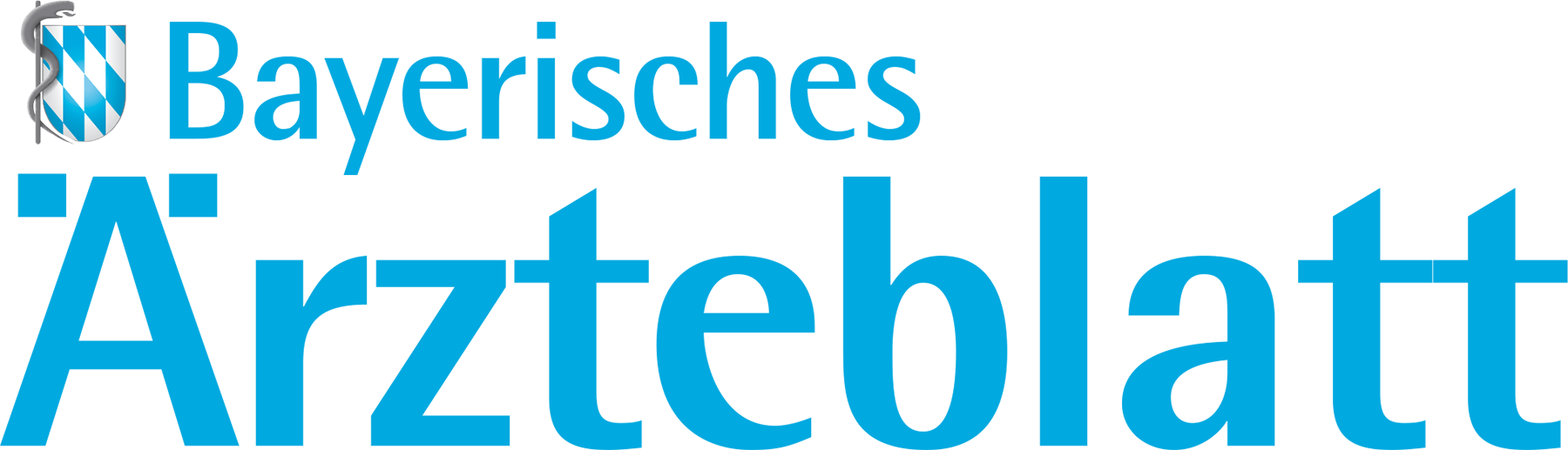
 Professor Dr. Philipp Sprengholz
Professor Dr. Philipp Sprengholz