COVID-19: Wo bleibt die „Theorie“ der Pandemie und Pathologie?
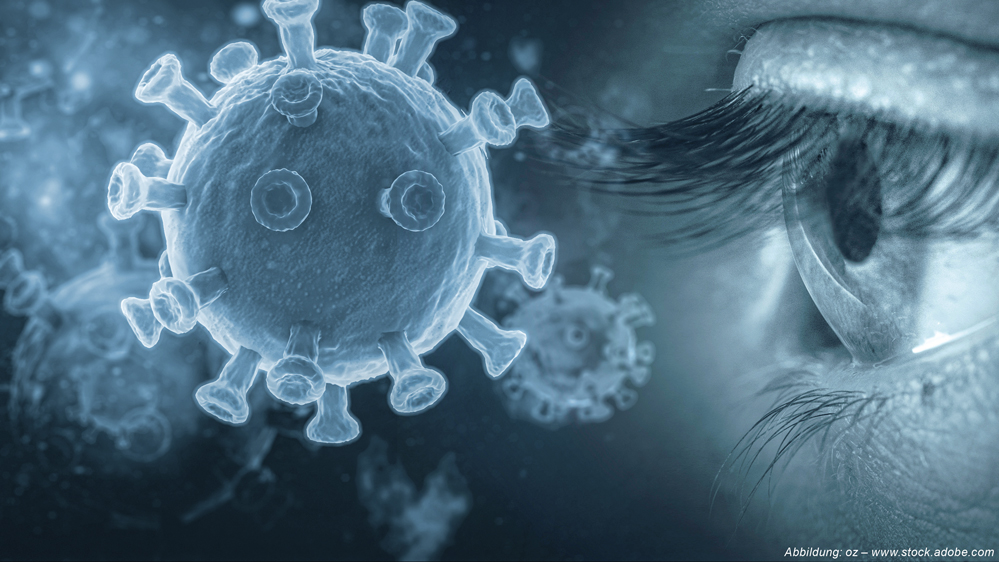 COVID-19 - Wo bleibt die "Theorie" der Pandemie und Pathologie?
COVID-19 - Wo bleibt die "Theorie" der Pandemie und Pathologie?
Trotz einer Vielzahl an Computersimulationen über die Entwicklung der Pandemie, ihr Ende oder ihr Übergang zur Endemie, mangelt es an medizinischen theoretischen Modellen, die die Pandemie besser verstehen lassen. Das gilt auch für eine Theorie der COVID-Pathologie, die Grundlagen für eine suffiziente Therapie bieten könnte.
1. Wann genau ist die Pandemie zu Ende?
In der Pandemie interessiert uns fast täglich, wie die 7-Tage-Inzidenz der Test-Positiven die nächsten zwei Wochen aussehen wird – bleibt sie gleich, fällt sie ab oder steigt sie an? Epidemiologen, meist medizinexterne Physiker, Statistiker und Mathematiker, haben uns gesagt, wie das aussehen wird. Dabei hatten sie unterschiedliche Trefferraten. Auf der Basis dieser Prognosen wurden allerdings auch die regulativen Maßnahmen wie Lockdowns empfohlen. Daraufhin gingen die Zahlen herunter, manchmal blieben sie gleich oder sie stiegen trotzdem an. Die Maßnahmen kamen manchmal zu spät, manchmal waren sie zu „hart“. Die Pandemie entwickelt offensichtlich eine Eigendynamik.
Für diesbezügliche Kalkulationen und Extrapolationen benutzen Epidemiologen zunächst die „Line of best fit“, eine mathematische Gleichung, welche die vorhandenen Daten am besten zusammenfasst, und dann wird in die Zukunft extrapoliert. Zur Vorhersage der Anzahl der Hospitalisierten und der Belegung der Intensivstationen werden allerdings vielgliedrige mathematische Modelle verwendet. Diese sind vom SIR-Modell als Grundmodell abgeleitet, bei dem die Bevölkerung in „S“ für Suszeptible, „I“ für Infizierte und „R“ für Remittierte unterteilt wird. In Form von Differenzialgleichungen und Parameter-Variationen wird auf diese Weise die Ausbreitungsdynamik modelliert. Dazu können auch Agenten-basierte Modelle verwendet werden, die das Kontaktverhalten der Menschen expliziter abbilden lassen [1].
Der kognitive Nutzen dieser Modellierungen besteht darin, die Pandemiedynamik passend zu beschreiben, über Simulationen zu explorieren und zukünftige Szenarien zu projizieren. Sie werden oft wegen ihrer mathematischen Form als „Theorie“ bezeichnet, doch ist der Formalismus ohne ein fachlich begründetes Ursachenmodell nicht ausreichend. Ihr Erklärungs- und Prognosepotenzial ist schwach, wenn man es auf verschiedene Länder und Situationen anwendet [2]. Die Grundschwierigkeit, aus Kontingenzen (bzw. Korrelationen) von Zahlen ohne Theorie Kausalitäten abzuleiten, wird offenbar.
Was wäre aber dann eine zufriedenstellende Theorie der Pandemie? Zu dieser Frage könnte man die Wissenschaftsphilosophie konsultieren [3].
2. Was ist eigentlich eine „Theorie“?
Grundlegend beruht die Wissensproduktion der Medizin auf einem Dreiecksverhältnis von Beobachtungen in der klinischen Praxis und Daten aus der Forschung als Empirie und auf Konstrukten als Theorie [4, 5]. Während Wissen aus der klinischen Praxis und aus Daten der empirischen Forschung nicht weiter erläutert werden muss, ist der Begriff der Theorie als etwas „Nicht-Empirisches“ sehr schillernd. Allerdings sind Empirie und Theorie immer aufeinander angewiesen, wie bereits Immanuel Kant entdeckte: Begriffe ohne Anschauungen sind leer, Anschauungen ohne Begriffe aber sind blind. Bereits alles, was nicht „da ist“, also beispielsweise Situationen, die die Zukunft betreffen wie eben Prognosen zur Inzidenz, sind etwas Theoretisches im weiteren Sinn. Prognosen sind also ein bestimmter Typ begründeter Fiktionen. Sie sind „Wenn-dann“-Szenarien, die beispielsweise einen exponentiellen Verlauf der Zahlen in die Zukunft projizieren. Das bedeutet, dass eine bestimmte mathematische Funktion, die beobachteten Zahlenmuster beschreibt und in die Zukunft fortschreiben lässt, und zwar derart, dass sie als Hypothese durch Beobachtung der Inzidenz der nächsten zwei Wochen geprüft und gegebenenfalls verworfen wird. Das gilt auch für die alltäglichen Wettervorhersagen, sie beruhen allerdings zusätzlich zu den Daten auch auf einigen physikalischen Erklärungstheorien des Wetters. In der Corona-Epidemiologie ist der Theoriehintergrund schwach. Allerdings kann ein Anstieg der Inzidenz im Herbst mit der kälteren Jahreszeit kausal begründet werden: weil die Menschen sich mehr in Innenräumen aufhalten und daher die Kontaktintensität steigt, nimmt auf diese Weise das Übertragungsrisiko zu. Abstrakter formuliert ist die Aussage „die Inzidenz wird zunehmen, weil die Temperatur sinken wird“, eine kausale These bzw. Hypothese, die einen Baustein einer notwendig komplexeren Theorie der Pandemie ausmacht.
Allgemein betrachtet sind daher „Theorien“ Konstruktionen über die Realität als Verallgemeinerungen, die im Wesentlichen auf empirischen Gesetzen bzw. Prinzipien beruhen, die durch Induktion aus Beobachtungen gewonnen wurden, und die in weitere Begründungen eingebunden sind [6]. Theorien bestehen aus einem Gefüge von Aussagen, die den Charakter von einfachen überprüfbaren Hypothesen haben können, und die in einem logischen Zusammenhang stehen und auf Grundannahmen beruhen. Sie ergeben komplexe „Weil-Antworten“ auf „Warum-Fragen“.
„Modelle“ hingegen sind weniger weitreichend, sie können ein Element einer Theorie sein, aber auch ohne Theorien sind sie Konstruktionen in Form von konzeptuellen Schemata, die helfen, Daten zu ordnen, sie nach Regeln zusammenzufassen und sie gegebenenfalls zu erklären und auch damit Prognosen zu machen. Beispielsweise sind Modelle in der Biomedizin meist mechanistisch, insofern sie pathogene molekulare Prozessstrukturen charakterisieren.
Zurück zur Theorie der Pandemie: Die Pandemie ist die weltweite Manifestation einer Infektion und Erkrankung vieler einzelner Menschen. Damit steht auch in Frage, wie denn das individuelle Risiko, an COVID-19 zu erkranken, durch eine bestimmte sozio-ökonomische und sozio-kulturelle Situation erklärt werden kann.
3. Theorie der Pathologie von COVID-19
Abstrakt, auf individueller Ebene betrachtet, und aus der Sicht der Virologie kann die Erkrankung an COVID-19 als Reaktion auf das Coronavirus erklärt werden. Eine derartige Aussage ist, allgemein formuliert, ein Stimulus-Response-Modell (S-R-Modell), das einen deterministischen bzw. probabilistischen Kausalzusammenhang zwischen Virus und Krankheit ausdrückt. Bereits Alltagsbeobachtungen zeigen jedoch, dass an SARS-CoV-2 Erkrankte im gleichen Haushalt lebende Personen nicht zwingend anstecken beziehungsweise krank machen. Diese Differenz bedeutet, dass es eine individuelle Vulnerabilität gegenüber dem Virus gibt, vermutlich durch (psychoneuro-)immunologische Faktoren, was auch durch Seroprävalenz-Studien bei Erwachsenen und Kindern statistisch belegt ist [7 bis 11]. Andererseits steigern Alter, Übergewicht, Diabetes mellitus, Hypertonus etc. das individuelle Erkrankungsrisiko. Daher muss das S-R-Modell um die komplexe Variable, Organismus erweitert werden und wird somit zum S-O-R-Modell. Allerdings müssen auch die erwähnten saisonalen Wellen der Pandemie mit ihren Temperatureffekten auf das Virus und, vor allem, auf das Individuum und sein Expositionsverhalten erklärt werden, sodass der Faktor Umwelt explizit in das Modell einbezogen werden muss. Physikalische Merkmale der Umwelt des Virus wie auch sozio-kulturelle und sozio-ökonomische Umweltfaktoren des Wirtes sind Variablen, welche die raumzeitlichen Differenzen der Prävalenz bzw. Inzidenz genauer erklären können. Damit sind wir allgemein beim klassischen infektionsepidemiologischen Kernmodell von John Snow: Das Beziehungsgefüge von Agens, Wirt und Umwelt kann als konzeptueller Rahmen spezifische Situationen am besten abbilden und durch weitergehende Differenzierungen präzisiert werden. Dieses infektionstheoretische Modell muss mit dem klassischen bio-psycho-sozialen Modell von George Engel als Rahmenmodell kombiniert werden, um möglichst viele Facetten des klinischen COVID-19-Problems explizit zu erfassen.
4. Perspektiven
Es wird deutlich: Was das Verstehen der Mechanismen der Coronapandemie auf kollektiver wie auch auf individueller Ebene betrifft, stehen wir vielleicht in einer ähnlichen Situation wie William Harvey, als er zu Beginn des 17. Jahrhunderts Mechanismen des Blutkreislaufs aufgedeckt hat und die experimentellen und klinischen Befunde mit Prinzipien verbunden hat. Es wären daher – so unsere These – Anstrengungen in Richtung einer theoretischen Medizin zweckmäßig. Sie müssten zwei Schwerpunkte haben:
a) Die Modelle in der Epidemiologie müssen stärker als bisher davon ausgehen, dass die Inzidenzzahlen das Resultat des Verhältnisses von Treibern und Dämpfern der Pandemie sind, die meist nicht direkt gemessen, sondern nur über indirekte Indikatoren (zum Beispiel Mobilitätsmessungen) ermittelt werden können. Die Modelle müssen vor allem verhaltens- und sozialwissenschaftlich ausgebaut werden und auch strukturell-systemische Wirkgrößen, wie beispielsweise Variablen des Lockdowns und des Gesundheitswesens, explizit in den Modellgleichungen abbilden. Auch die Dynamik des Funktionskreislaufes des gesamtgesellschaftlichen Corona-Managements, vom Virus als Störgröße ausgehend, über die Bevölkerungsgesundheit, gemessen durch die medizinische Wissenschaft über die Infektionsrate, bis zur politischen Maßnahmen-Entscheidung mit der Folge der behördlichen Umsetzung und der Annahme der Verhaltensregularien durch die Bevölkerung, bis wieder zur medizinischen Einschätzung der Effekte neuer Virus-Mutanten, all dies muss eigentlich als kontrolltheoretisches Rahmenmodell der Pandemiedynamik ausformuliert werden [12, 13].
b) Darüber hinaus ist trotz der submikroskopischen Dimension des Krankheitserregers im Lichte der Fortschritte der molekularen Medizin der Rahmen einer schon fast vergessenen organismusbezogenen Pathophysiologie hilfreich, um die Vielgestaltigkeit der organischen und psychischen COVID-19-Manifestationen miteinander in einem umfassenderen und klinisch relevanten Krankheitsverständnis in Beziehung setzen zu können. Ein derartiges Systemmodell kann Orientierungen für rationale medikamentöse Interventionen bieten [14].
Beide Erklärungsansätze begründen zusammengenommen die Forderung, eine theoretische Medizin zu entwickeln. Aber auch das Nachdenken über das Forschen und Denken in der Medizin, was in die fast nicht vorhandene Wissenschaftsphilosophie der Medizin mündet, verdient eine stärkere Institutionalisierung, um die Weiterentwicklung der Medizin zu unterstützen: die Aussicht auf essentielle Evidenzsteigerung durch Daten ohne Theorie (Big Data) ist begrenzt. Deshalb sind die Lehrstühle für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin dringlich gefordert, den Bereich „Theoretische Medizin“ und „Metatheorie der Medizin“ auszubauen, denn – nach Kurt Lewin – „ist nichts praktischer als eine gute Theorie“.
Das Literaturverzeichnis kann im Internet unter www.bayerisches-aerzteblatt.de (Aktuelles Heft) abgerufen werden.
Autoren
Professor Dr. Dr. phil. Dr. rer. pol. Felix Tretter
Bertalanffy Center for the Study of Systems Science, Wien
Dr. Marc Batschkus
Archiware GmbH, München
Professor Dr. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. Dieter Adam
ehem. Dr. von Haunersches Kinderspital der Universität München
Teilen:
Das könnte Sie auch interessieren:






