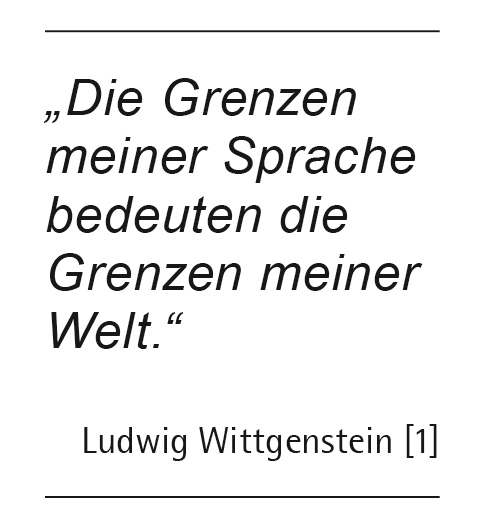COVID-19: Medizin, Politik und Öffentlichkeit ‒ Wissenschaftstheoretishe und -praktische Reflexionen
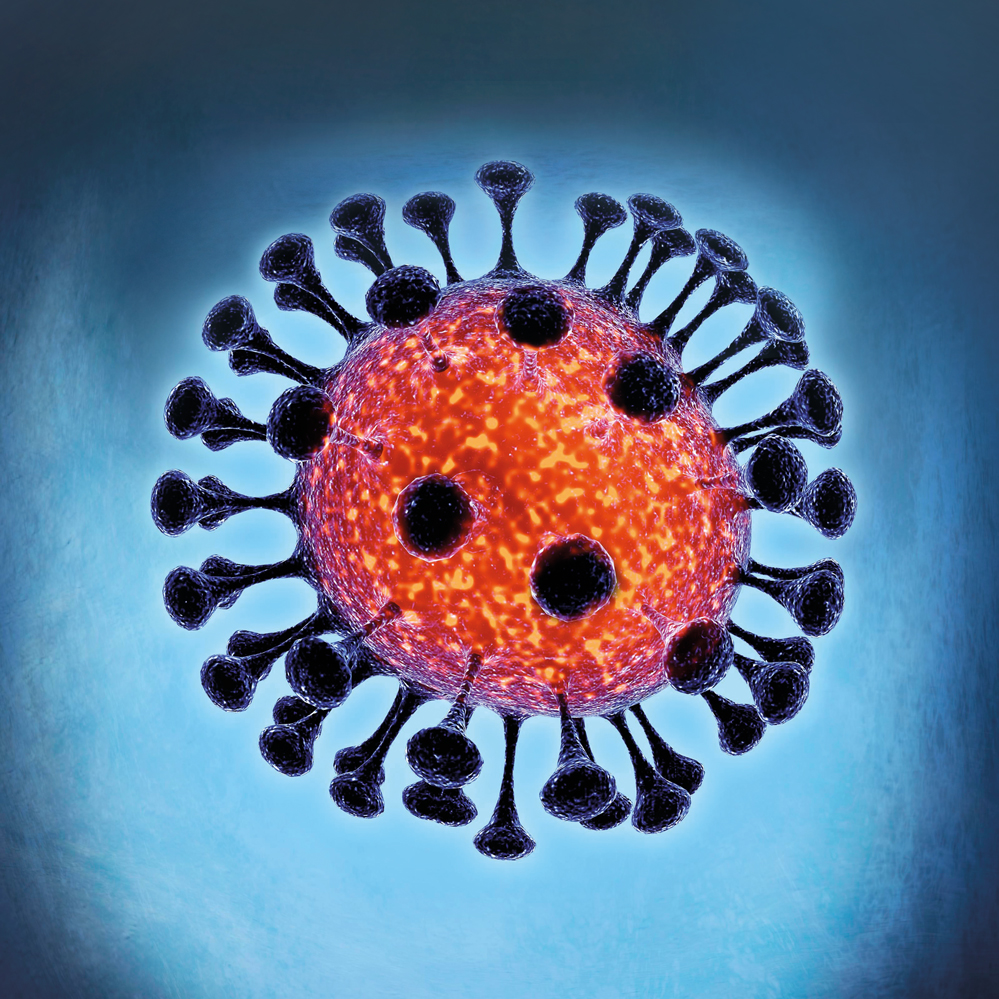 COVID-19: Medizin, Politik und Öffentlichkeit
COVID-19: Medizin, Politik und Öffentlichkeit
COVID-19 und die Medizin für die Gesellschaft
Die COVID-19-Pandemie war und ist ein medizinisch und gesellschaftlich neuartiges Phänomen. Es musste bei wenig Wissen umfassend gehandelt werden. So wurde, im Europa-Vergleich, in Deutschland und Österreich durch ein gutes Zusammenspiel von Medizin, Politik, Medien, Behörden und Bevölkerung ein sehr überzeugendes Krisenmanagement realisiert: Die niedrige bevölkerungsbezogene Quote der von SARS-CoV-2-Infizierten (ca. zwei Promille), der damit assoziierten Toten (ca. 0,09 Promille) und die Dämpfung der epidemischen Dynamik als Outcome sind zufriedenstellend. Es wurde auch deutlich, dass Sozialstaaten, die weniger Privatisierung des Gesundheitswesens aufweisen und ihre Bürger in wirtschaftlichen Notlagen gut stützen, ganz gut durchgekommen sind.
Für den Winter 2020/2021 bestehen allerdings wieder hohe Anforderungen an die medizinische Praxis: effiziente Differenzialdiagnostik bei Erkältungssymptomen, logistische, personelle und infrastrukturelle Basis dafür und für den Krisenfall, qualitativ bessere Tests, Formen eines zwar partiellen gesundheits- aber auch familien- und wirtschaftsverträglichen Lockdowns und so weiter. Das muss auch adäquat fachextern kommuniziert werden. Für diese Aufgaben ist eine Reflexion des unmittelbar Vergangenen sinnvoll.
In der jetzigen postakuten Phase, nach dem „Lockdown-Hammer“ und nun im „Dance“ auf einer möglichen zweiten Welle [3] finden bereits die Hygieneempfehlungen außerhalb der Medizin zunehmend weniger Resonanz. Somit ist es höchste Zeit für eine „Epikrise“ zum Nachdenken.
Handeln bei Ungewissheit – wichtige Einsichten und Grundfragen
Nach dem erfolgreichen akuten Handeln stellen sich grundlegendere Fragen wie: „Was war wirklich wirksam?“, „Wie ist das Verhältnis von Hygieneregeln und Freiheitsrechten?“, „Wie verhält sich die Medizin zur Ökonomie?“ und „Was ist ‚gute‘ Wissenschaft?“. Hier versteckt sich vor allem die Frage: Welche Realität verbirgt sich hinter den Zahlen? Wissenschaftstheoretisch fundierte Antworten zu diesen Fragen sind für die nächste Welle oder Krise hilfreich [4]. Angesichts der hohen Eigendynamik der Epidemie/Pandemie muss der Wissensfortschritt genau überprüft werden. Es geht schließlich um das weitere gesellschaftliche Vertrauen in die Medizin als Wissenschaft und als Public Health-Akteur, und zwar, was die Maßnahmen-Adhärenz in der Bevölkerung anbelangt. Denn vor allem die Klarstellung des Attributs „Wissenschaftlichkeit“ als logisch-empirische, aber kritische Rationalität erlaubt es, Corona-Alarmisten, Corona-Skeptiker und Corona-Leugner zum Corona-Realismus hinzuführen und mit anderen Sichtweisen zu balancieren.
Folgende Aspekte des ersten Halbjahres 2020, hier als Thesen oder Fragen formuliert, erscheinen uns bearbeitungswürdig (siehe Anmerkungen/Literaturverzeichnis auf www.bayerisches-aerzteblatt.de):
Praxis hat bei neuen Krankheiten Erkenntnisvorsprung!
Die erste öffentliche Warnung vor dem Virus geht offensichtlich auf den jungen chinesischen Augenarzt Li Wenliang zurück, der Ende Dezember 2019 in einem Chatroom von schweren untypischen Pneumonien in seiner Klinik in Wuhan berichtete. Er war wenig später selbst infiziert und starb Anfang Februar 33-jährig an COVID-19 [5].
Sein Hinweis und auch sein Schicksal wurden zu wenig und zu spät beachtet, und auch jetzt kommen niedergelassene Ärztinnen und Ärzte) mit ihren Erfahrungen zu wenig zu Wort. Diese Nachrangigkeit der Praxis bei der medizinischen Wahrheitsfindung, wie sie die Evidenzbasierte Medizin (EbM) mit ihrer Präferenz für randomized controlled trials (RCTs) vorsieht, ist in derartig neuen Situationen kontraproduktiv, vernünftige „Face validity“ muss zunächst reichen. Weiterführend wäre hier eine Gleichstellung von Praxis mit der Forschung in „transdisziplinären Diskursen“, ohne „Message control“ und auch mit Kritikern (Anmerkung 1). Nicht zuletzt sollte die Politik nun die „Systemrelevanz“ der praktischen Gesundheitsberufe mit einer strukturellen und finanziellen Stärkung anerkennen.
Schlüsselbegriffe müssen definiert werden!
In der Verständigung über die Pandemie wird bereits die Unterscheidung von Prävalenz als Bestandsgröße und Inzidenz als Änderungsgröße oft nicht beachtet. Besonders wichtig sind aber Begriffe zur „Gefährlichkeit“ des Virus (Anmerkung 2):
a) Die pathogenetische Gefährlichkeit des Virus auf Bevölkerungsebene kann zunächst nach dem spezifischen Sterberisiko bei einer Infektion beurteilt werden (fallbezogene Letalität; case fatality rate, CFR). Aber auch der Vergleich mit anderen Indikatoren der Sterberisiken, beispielsweise bezogen auf die serologisch ermittelten Infizierten (Infection Fatality Rate, IFR) oder gar die bevölkerungsbezoge Mortalität; (Tote/100.000 Einwohner) erfassen verschiedene Gefährdungsdimensionen [6]. Bemerkenswert dazu ist, dass eine geringe Mortalität ohne Angabe der Infektionsquote der Bevölkerung generell keine belastbare krankheitsbezogene Aussage erlaubt, die CFR liegt deutlich höher, ist aber diesbezüglich zutreffender. Die IFR bei COVID-19 ist wegen der gegenwärtig schätzungsweise fünffach höheren Quote an asymptomatisch versus symptomatisch Infizierten wiederum deutlich niedriger als die CFR. Zur öffentlichen Beruhigung kann daher die Mortalität gewählt werden (D, A: < 0,1 Promille), zur Aktivierung hilft die CFR (D, A: ca. drei Prozent), korrekter wäre die (geschätzte) IFR (D, A: ca. 0,6 Prozent). Allerdings umfasst die epidemiologische Terminologie zur Sterblichkeit fast ein Dutzend weiterer Begriffs- und Kalkulationsvarianten, weshalb jeweils Klärungen des gewählten Indikators erforderlich sind [7, 8]. Hierbei ist in Hinblick auf die Sterbefälle auch noch zu unterscheiden, ob jemand mit oder wegen SARS-CoV-2 gestorben ist. Für kausale Analysen sind Geschlecht, Alter, BMI, Komorbiditäten, und so weiter, aber auch Versorgungssystemparameter (zum Beispiel: Intensivbetten/100.000 Einwohner) relevant.
Zur Charakterisierung der epidemiologischen Ausbreitungsdynamik wird der Indikator „Verdoppelungsintervall“ oder die „effektive Reproduktionszahl“ (Reff) verwendet. Beide Konzepte zeigen begriffliche und kalkulatorische Probleme (siehe „Modellierungen sind Bilder
der Wirklichkeit!“).
b) Auch pathologisch lässt sich die Gefährlichkeit des Virus sowohl klinisch charakterisieren, insofern MRT-Bilder der Lunge auch junger Patientinnen und Patienten gravierende Veränderungen zeigen können, was das Atemnotsyndrom auch für Laien verständlich macht (zum Beispiel bei Defektheilungen). Auch visualisierte pathophysiologische Erklärungsmodelle lassen für Interessierte bei entsprechender Didaktik die Virulenz und Multiorgan-Pathogenität des Virus erkennen. Folglich wären integrativ interdisziplinäre Beschreibungen und Bewertungen, die mehrere Dimensionen des Schädigungspotenzials des Virus erfassen, sinnvoll.
Testen, Testen, Testen … ?
Der (nötige) Empirismus der Medizin verlangt mehr Tests, aber die Geschwindigkeit und Qualität – vor allem der gesamten Prozedur von der Anforderung der Testung bis zur behördlichen Ergebnis-Meldung und weiteren Veranlassung – ist mit bis zu acht Tagen noch nicht zufriedenstellend. Bereits die Indikationsstellung der Testung lässt neben den Organisationsherausforderungen Optimierungsbedarf erkennen. Auch ist – bei neuen Viren nicht verwunderlich – die Test-Spezifität zu verbessern, und auch die Sensitvität benötigt infektionsphasenspezifische Relativierungen [9]. Dies vor allem wegen dem psychosozialen Problem der Quarantänisierung der „falsch Positiven“ mit den individuellen (und kollektiven) sozialen, ökonomischen und rechtlichen Nebeneffekten (Anmerkung 3).
„Daten“ produzieren Schatten der Wirklichkeit!
a) Datenerfassung: Der allseitige Datenhunger ist verständlich und so wurde viel publiziert, aber einige dieser Arbeiten mussten wegen Datenmängeln bereits wieder zurückgezogen werden. Es muss nun allmählich klarer werden, dass auch ein Nachdenken über die Situation einen stärkeren Stellenwert haben muss. Zu beachten ist auch, dass die an einem Tag X veröffentlichten Zahlen wegen der Verarbeitungslatenz nur die Situation von ein paar Tagen vorher abbilden können. Dies ist für die Prävention und die Effektivitäts-Evaluation der Maßnahmen wichtig (siehe „Maßnahmen und ihre Evaluation“). Auch wir können hier nur grobe Zahlenwerte anführen, es geht uns aber um prinzipielle Fragen.
b) Datenanalytik: Das nichtlineare Anwachsen der Zahlen, oft nur teilweise zutreffend als
exponentieller Verlauf bezeichnet, wurde über Interpolationen der Datenpunkte durch mathematische Funktionen charakterisiert. Aber nicht nur die Deskription der Kurve, sondern vor allem die Prädiktion ist problematisch, weil a priori nicht gewusst werden kann, wann die Kurve abflacht, also linear oder „unterlinear“ weiterverläuft: die 95 Prozent Prädiktionsintervalle scherten oft bereits nach wenigen Prognose-Tagen stark auseinander.
c) Folglich ist die Wirklichkeit durch Daten und Datenanalytik alleine, ohne fachtheoretische Überlegungen und inhaltlichen Hypothesen nur eine sehr grobe Heuristik. Der Gegenstand der Forschung, die Epidemie/Pandemie, ist nämlich ein sich selbst-organisierendes heterogenes dynamisches System mit starker Eigenlogik, wo Nachweiskriterien der EbM (zum Beispiel RCTs) nur sehr begrenzt zutreffend sind [10, 11].
Wie also schon Vorhersagen des Wetters oder der Börsenkurse zeigen, ist nach Karl Valentin „die Zukunft nicht mehr das, was sie einmal war“ (Anmerkung 4).
Modellierungen sind Bilder der Wirklichkeit!
Die epidemiologischen Systemmodelle müssen richtig eingeschätzt werden, denn die S-E-I-R-Modelle bilden zwar die Dynamik der Größe verschiedener Bevölkerungsgruppen bezüglich der Suszeptibilität (S), der Exposition (E), der Infizierten (I) und der Rekonvaleszierten (Recovered, R) prinzipiell gut ab, aber sie bedürfen täglich neuer Berechnungen [12]. Auch sie erlauben nur kurzfristige Wenn-dann-Prognosen mit erheblichen Streuungen. Besonders bedeutsam in diesem Differenzialgleichungssystem der Epidemiebeschreibung ist die erwähnte effektive Reproduktionszahl (Reff), die sich theoretisch aus dem Produkt der Kontakte pro Zeiteinheit, der Infektionsrate pro Kontakt und der Dauer der Infektiösität der betreffenden Person ergibt. Diese Zahlen müssen in der Praxis geschätzt werden, wobei verschiedene statistische Annahmen einfließen [13]. In Deutschland und Österreich war die durchschnittliche Reff um den 10. März maximal bei etwa drei, reduzierte sich daraufhin bis Anfang April auf ca. eins und blieb dann auf diesem Niveau. Hygiene-Maßnahmen wurden aber erst um Mitte März implementiert. Daher ist die Reff kein praktischer Ziel-Indikator, da er am Darstellungstag die Verhältnisse vor etwa einer Woche wiedergibt [14]. Praktischer ist es, die täglich „Neuinfizierten“, bei denen „Bruchpunkte“ identifiziert werden können [15], als Effekte von Maßnahmen anzusehen (Anmerkung 5).
Maßnahmen und ihre Evaluation – was ist effektiver: „Distancing“ oder Mund-Nase-Masken?
Epidemien durch übertragbare Krankheiten können, wenn keine Impfung zur Verfügung steht, verständlicherweise am besten durch „Distancing“ eingedämmt werden. In differenzierten Situationen, wie es die modernen Gesellschaften mit ihren komplexen Lebenswelten sind, müssen – um Kollateralschäden zu minimieren – möglichst spezifische Präventionsmaßnahmen geplant und umgesetzt werden: Verbot von Großveranstaltungen, keine Treffen in geschlossenen Räumen, Maskenpflicht, Schulschließungen, Besuchsverbote in Krankenhäusern und Heimen, usw. Nach mehreren Wochen kann dann evaluiert werden, welche der Maßnahmen am effizientesten gewesen sind, beispielsweise bezüglich der Reff. Man kann sich dazu eine multiple Regressionsgleichung vorstellen. Das ist bisher nicht zufriedenstellend gelungen, denn viele der vorher genannten Methodenmängel wurden in diesen Studien nicht ausreichend berücksichtigt. Einfache, rückblickende Kausalanalysen verschiedener Hygienemaßnahmen legen nahe, dass die stärkste Dämpfung der epidemischen Dynamik in Deutschland, der Schweiz und in Österreich durch das Verbot von Großveranstaltungen, und weniger durch Ausgangsverbote erzielt wurde [16, 17]. Es gilt oft: Effekte sind nicht bewiesen, aber auch nicht ausgeschlossen (Anmerkung 6).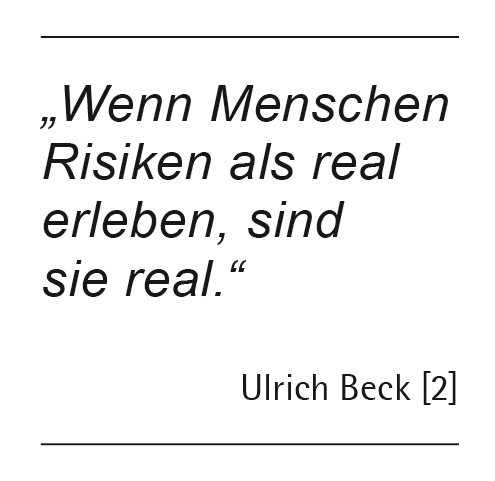
„Integrierte Medizin“ ist nötig!
Die Neuheit des Virus bringt intensiven Orientierungsbedarf mit sich. Der passende Umgang mit dem Nichtwissen kann als hypothesengeleiteter Erkenntnisprozess im Sinne des kritischen Rationalismus und logischen Empirismus beschrieben werden, der den konstruktivistischen Charakter von Wissenschaft mit bedenkt. Dazu gibt es aber einige Desiderate:
a) Intradisziplinärer Meinungspluralismus: Virologie gilt nun als führende Spezialdisziplin der Medizin. Aber auch Virologen sind trotz naturwissenschaftlicher Gegenstandsbeschreibung nicht immer einer Meinung. Es geht in diesem Fall um die Umgehensweise mit anderen Meinungen, also um Präferenzen für einen Wissenschaftsstil, bei dem nur gesichertes Wissen an die Öffentlichkeit gelangen soll, also eine Art Message control erfolgen soll, oder ob ein offener Diskurs zur Transparenzsteigerung bevorzugt wird. Und überhaupt: Wie regierungskonform muss und darf die Wissenschaft als „institutionalisierter Skeptizismus“ in dieser Situation sein?
b) Multidisziplinarität der Medizin: Grundsätzlich ist die Corona-Pandemie nur im innermedizinischen interdisziplinären Diskurs zu verstehen und adäquat zu managen: Kenntnisse haben Virologen vom Verhalten der Viren, Epidemiologen von deren Verbreitung über Infizierte, Hygieniker von effektiven Vorbeugemaßnahmen, Infektiologen von den klinischen Besonderheiten, Internisten von den symptomatischen Behandlungsoptionen, Pathologen von relevanten Organstrukturveränderungen, Allgemeinärzte von der Situation der Kranken in ihrem Wohnumfeld usw. Die verschiedenen Sichtweisen – Labor, Fallstatistiken, Modellbildung, Pathologie, Schutzmaßnahmen – zeichnen ein schwer verständliches, bruchstückhaftes Mosaikbild der Epidemie und damit von dem zielgerechten Handlungsbedarf. Es liegt eine „assoziative“ aber nicht „integrative“ Multidisziplinarität vor, die offensichtlich nicht in einen konzeptuellen Rahmen eingebettet werden kann. Nimmt man noch die (Gesundheits-)Ökonomen dazu, dann öffnet sich noch das politische Konfliktfeld „Ethik versus Monetik“ [18].
c) „Integrierte“ statt „assoziative“ Interdisziplinarität ist nötig: „Jeder sagt seine Meinung“ spiegelt ein demokratisches Wissenschaftskonzept, aber diese Differenzen sind Nährboden für Verschwörungstheoretiker. Bemühungen um Konsistenzen zwischen verschiedenen medizininternen Fachperspektiven, die vom Betrachter hergesehen, zum Teil schon wegen ihrer Spezialisierungen widersprüchlich erscheinen, wären dazu hilfreich.
d) Verbindungen der Medizin mit anderen Fachgebieten: Es wird deutlich, dass die Hygienemaßnahmen mit Wirtschaftsinteressen kollidieren, auch verschiedene Rechtsbereiche sind negativ berührt. Es stellt sich die Frage, ob die Medizin bei ihrem Standpunkt bleiben und ob dann von Dritten über Konflikte diskursiv abgestimmt werden sollte. Oder, ob die Medizin andere – „extradisziplinäre“ – Gesichtspunkte einbeziehen und sich bei der Kompromisssuche beteiligen sollte. Letzteres verführt zu „faulen“ Kompromissen, wäre aber fairer. Diese Integration der Perspektiven wäre auf systemwissenschaftlicher Ebene möglich [19, 20]. So könnte die Medizin mit anderen Disziplinen auch entscheidungsvorbereitend die Politik entlasten und sie zugleich auch fordern, weiterhin transparent und evidenzbasiert zu agieren.
Wo bleibt der Mensch?
Die sinnvollen Hygiene-Maßnahmen wie die Heim-Quarantäne, die nur die physische Distanz zum Ziel hat, bewirkt auch soziale Distanz. Das erleben viele Menschen als bedrückend und einengend, neben Heimbewohnern auch junge Menschen. Es fehlt der pragmatischen Krisenmedizin die subjektive Seite, ein Menschenbild, das die „Ökologie der Person“ mitdenkt und die Maßnahmen dementsprechend anpasst. Die psychosozialen Effekte der Isolierung, schon mit der banalen Frage der Grundversorgung im Haushalt, ist nicht ausreichend bedacht.
Öffentlichkeit, Recht, Wirtschaft, Politik und Ökologie als Grenzgebiete der Medizin
a) Die Öffentlichkeit muss minimalmissverständlich mit wissenschaftlichen Informationen versorgt werden. Nachrichtenredaktionen müssen über ihre Wissenschaftsredaktionen die Qualität sichern. Viele Informationen sind allerdings eine didaktische Herausforderung. Es wäre dringend geboten, die Corona-Berichte medienwissenschaftlich zu untersuchen, um zu evidenzbasierten medialen Gestaltungsempfehlungen zu gelangen.
b) Recht: Einschränkungen der Bewegungsfreiheit betreffen elementare Bedürfnisse, Nähe und Distanz zu regulieren. Diese sind sinngemäß in der Verfassung zugesichert. Sie kollidieren aber mit dem Interesse des Gemeinwohls und können durch Notstandsgesetze eingeschränkt werden. Darüber wird derzeit diskutiert.
c) Die Wirtschaft muss von der Medizin berücksichtigt werden. Am Maximum der Epidemie bestand ein Konflikt, der auf den Punkt gebracht besagt, dass „ein verhinderter COVID-Toter bis zu 1.000 Arbeitslose mit sich bringt“. Dieser ethische Konflikt muss offen angegangen werden (Anmerkung 7).
d) Wirtschaftspolitik muss resilientere lokale, regionale und nationale Versorgungsstrukturen für systemrelevante Güter und Dienstleistungen aufbauen.
e) Politik: Die demokratischen Strukturen sind einem Stress-Test sondergleichen ausgesetzt, bei dem auch Schwachstellen erkannt und verbessert werden müssen. Digitale Überwachung kann nicht die Lösung sein.
f) Zoonosen, also unser Verhältnis zu Tieren (und natürlichen Ökosystemen überhaupt) muss ernster betrachtet werden.
Diese Aspekte verweisen darauf, dass „das große Ganze“ mit seinen systemischen Zusammenhängen anzudenken ist. Dabei müssen sich vor allem Medizin und Wirtschaft verständigen, wo ja durch die Gesundheitsökonomik Verbindungen bestehen, die allerdings nicht methodisch eindimensional nur auf die Monetarisierung von Werten konzentriert sein dürfen.
Ausblick
Bis zur biotechnologischen Lösung des Corona-Problems durch Therapie und Impfung, und der Wirkung von digitalen Technologien wie die Corona-App zur Früherkennung und -intervention der Epidemie-Dynamik muss über wohlbekannte verhaltens- und verhältnisorientierte Hygienemaßnahmen gehandelt werden. Dazu muss die Resilienz des Versorgungsystems, insbesondere was den personellen Bereich betrifft, ausgebaut werden. Für die nötige hohe Adhärenz in der Bevölkerung gegenüber den sinnvollen Hygiene-Maßnahmen sind allerdings die wissenschaftlichen Grundlagen der entsprechenden Handlungsorientierungen auf ihre Konsistenz hin zu überprüfen (Konsistenz-Konferenzen). Darüber hinaus erscheint ein sachlicher medizinübergreifender Diskurs wünschenswert. COVID-19 hat auch gezeigt, dass eine Rückführung auf europäische Produktionsstätten medizinrelevanter Produkte hilfreich wäre. Dieses Multi-Tasking stellt eine große Herausforderung auch für Staat und Politik dar.
Die Anmerkungen sowie das Literaturverzeichnis können im Internet unter www.bayerisches-aerzteblatt.de (Aktuelles Heft) abgerufen werden.
Autoren
Professor Dr. Dr. phil. Dr. rer. pol. Felix Tretter
Vicepresident, Bertalanffy Center for
the Study of Systems Science,
Paulanergasse 13/2.Stck., A-1040 Wien
Professor Dr. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. Dieter Adam
ehem. Dr. von Haunersches Kinderspital
der Universität München, Lindwurmstraße 4, 80337 München
Korrespondenzadresse:
Professor Dr. Dr. phil. Dr. rer. pol. Felix Tretter, E-Mail: felix.tretter(at)bcsss.org
Teilen:
Das könnte Sie auch interessieren: