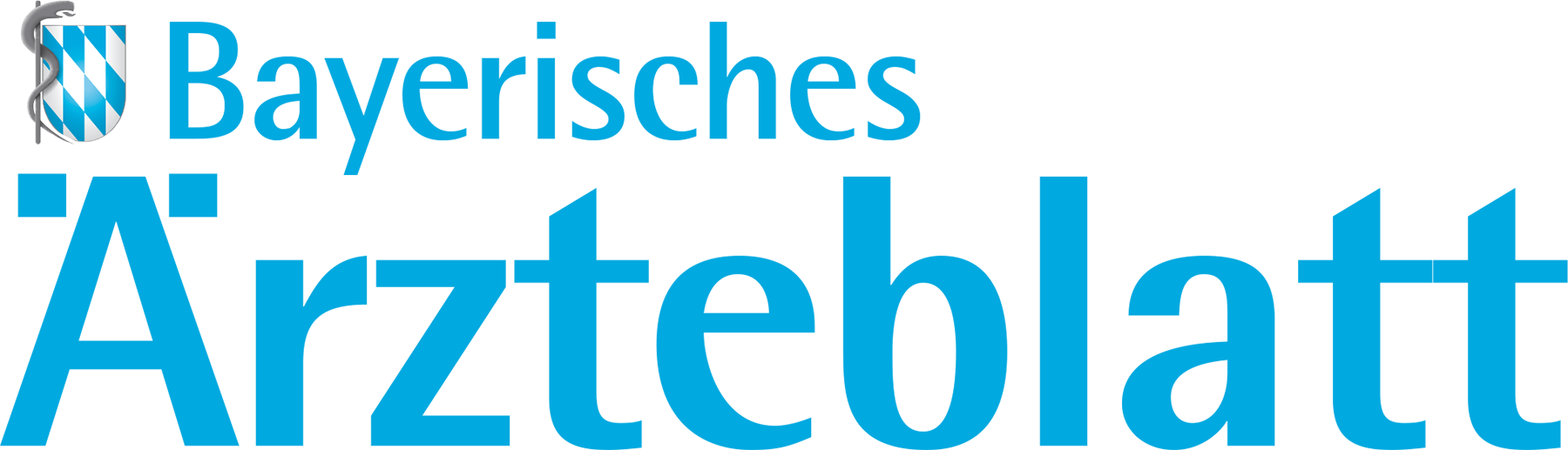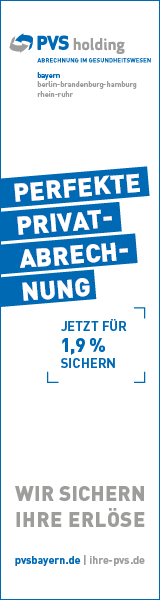Vom Gefechtsfeld ins Krankenhaus

Wie der Sanitätsdienst der Bundeswehr in Feldkirchen den Ernstfall probt
Aus der Ferne halte ich den Atem an. Am Waldrand schält sich ein Transportpanzer Fuchs aus dem Schatten der Bäume. Pioniere springen mit routinierter Präzision aus dem Fahrzeug, sichern das Gelände und beginnen konzentriert, ein Minenfeld anzulegen. Ihr Auftrag: Den Vormarsch mechanisierter Feindverbände aufhalten.
Doch über den Baumwipfeln lauert die Gefahr. Eine feindliche Drohne schwebt heran – kaum hörbar, kaum sichtbar. Wie ein dunkler Schatten gleitet sie über die Gruppe, zieht in Position. Dann löst sich der Sprengsatz, eine Mörsergranate. Die Detonation zerreißt die Stille. Ein gleißender Lichtblitz, ein gewaltiger Knall – gefolgt von den Schreien der Verletzten. Drei Soldaten gehen getroffen zu Boden. Ihre Kameraden stürzen herbei, pressen Verbände auf die blutenden Wunden. Jeder Handgriff zählt, denn sie wissen: Bereits ein Blutverlust von 2,5 Litern kann lebensbedrohlich sein. Mit letzter Kraft werden die Verwundeten in den Fuchs getragen. Der Motor heult auf, die Reifen greifen in den Boden, und der Panzer schießt mit bis zu 105 km/h los in Richtung Verwundetensammelpunkt. Ein Wettlauf gegen die Zeit hat begonnen.
Was wie ein Kriegsschauplatz wirkt, ist in Wahrheit Teil der Informations- und Lehrübung des Sanitätsdienstes der Bundeswehr (ILÜ San) an der Gäubodenkaserne im niederbayerischen Feldkirchen – eine der größten militärmedizinischen Übungen Europas. Mit dabei: Journalistinnen und Journalisten des Bayerischen Rundfunks, von SAT.1 und ich vom Bayerischen Ärzteblatt. Wir sind Zeugen eines Szenarios, das angesichts des Kriegs in der Ukraine keine abwegige Dystopie mehr zu sein scheint.
„Das menschen- und werteverachtende Vorgehen Russlands in der Ukraine zeigt, wie wichtig kriegstüchtige Streitkräfte, ein kriegstüchtiger Sanitätsdienst und ein resilientes Gesundheitssystem für die Abschreckung und Abwehr solcher Angriffe sind. Mit der ILÜ San bekommen Besucherinnen und Besucher aus Politik, Ministerien, Verwaltung, dem zivilen Gesundheitssystem, Blaulichtorganisationen sowie internationale und nationale militärische Partner das gesamte Spektrum der sanitätsdienstlichen Versorgung von der vordersten Gefechtszone bis zur Rehabilitation im Heimatland gezeigt“, erklärt mir Generaloberstabsarzt Dr. Ralf Hoffmann, Befehlshaber des Zentralen Sanitätsdienstes der Bundeswehr und zugleich Wehrmedizinischer Berater des Bundesministers der Verteidigung, Boris Pistorius (SPD).
Erste Hilfe im Gefecht
Zurück zu den Pionieren: Am geschützten Sammelpunkt übernehmen Einsatzersthelferinnen und -ersthelfer der Stufe „Bravo“ die Versorgung der verwundeten Darsteller. In acht Tagen Intensivtraining haben sie sich auf invasive, lebensrettende Maßnahmen unter Gefechtsbedingungen vorbereitet. Sie arbeiten nach dem sogenannten MARCH-Schema (Massive Bleeding, Airway, Respiration, Circulation, Head/Hypothermia). Zuerst stillen sie kritische Blutungen mit Tourniquets und Druckverbänden, dann sichern sie die Atemwege, kontrollieren die Atmung und stabilisieren den Kreislauf. Abschließend widmen sich die Ersthelfer der Versorgung von Kopfverletzungen und stellen sicher, dass keine Unterkühlung eintritt.
Bei den eingetroffenen Verwundeten werden typische Gefechtsverletzungen festgestellt und behandelt. Dazu gehören unter anderem Frakturen, Verbrennungen, tiefe Weichteilverletzungen, Thoraxtraumen sowie Schrapnellwunden. Die Versorgung erfolge dabei stets im Rahmen der verfügbaren Ressourcen und unter Berücksichtigung der priorisierten Gefahrenlage, erklärt Generalarzt Dr. Bruno Most, stellvertretender Kommandeur Kommando Sanitätsdienstliche Einsatzunterstützung in Weißenfels.
Kurze Zeit später braust ein gepanzertes Sanitätsfahrzeug „GTK Boxer“ heran, besetzt mit zwei Notfallsanitätern und einem Fahrer. Die Verwundeten werden in den Boxer verladen und zu einer nahegelegenen mobilen Rettungsstation transportiert. Ein besonders schwer verletzter Soldat wird hingegen in die Sanitätsdrohne „Grille“ überführt, die in der Lage ist, ein Einsatzlazarett direkt anzufliegen. Die rund 2,5 Millionen Euro teure Drohne verfügt laut Herstellerdaten über eine Reichweite von 51 Kilometern sowie eine maximale Geschwindigkeit von 86 km/h und wird durch ein zentrales Flugkontrollsystem überwacht. Während des gesamten Flugs werden die Vitaldaten der Patientinnen und Patienten kontinuierlich erfasst und in Echtzeit an das medizinische Fachpersonal übermittelt. Derzeit wird die „Grille“ von der Bundeswehr ausschließlich zu Demonstrationszwecken eingesetzt; eine reguläre Beschaffung des Systems ist bislang noch Gegenstand militärischer Überlegungen, so Most.

Ein Verwundeten-Darsteller wird in das gepanzerte Sanitätsfahrzeug GTK Boxer verladen.
Triage und Notaufnahme
An der Rettungsstation „Role 1“ – einem hochmobilen System zur sofortigen notfallmedizinischen Sichtung und Versorgung, bestehend aus einem Trägerfahrzeug mit geschütztem Behandlungscontainer, einem Anhänger als Versorgungspalette und einem Zelt – nimmt Oberfeldarzt Dr. Daniel Forstner, Facharzt für Allgemeinmedizin, inzwischen mit seinem Team die Triage der eintreffenden Verwundeten vor. Dabei erfolgt die Einteilung in die Kategorien Rot, Gelb, Grün sowie Blau, wobei die Behandlungspriorität je nach Schweregrad festgelegt wird: Kategorie Rot steht für eine akute vitale Bedrohung, Kategorie Gelb für schwere Verletzungen und Kategorie Grün für leichte Verletzungen.Die Kennfarbe Blau kennzeichnet Verwundete ohne Überlebenschance. Darüber hinaus existiert die Kategorie Schwarz für Soldatinnen und Soldaten, die beim Eintreffen bereits verstorben sind. Zu den Aufgaben der maximal sechs Stunden autonom durchhaltefähigen Rettungsstation mit vier Behandlungsplätzen zähle neben der Sicherung der Vitalfunktionen die Stabilisierung der Patienten für den anschließenden Weitertransport in die nächsthöhere Versorgungsebene, erklärt Forstner.

Sanitätsdrohne „Grille“
Einen solchen entlastenden Patiententransport, eindrucksvoll durchgeführt durch mehrere GTK Boxer, können wir versammelte Journalisten „live“ beobachten, bevor wir von den Soldaten zum nächsten Glied der Rettungskette gebracht werden – einem voll funktionsfähigen mobilen Rettungszentrum, dessen geschäftiges Innenleben wir von einer Tribüne aus der Vogelperspektive beobachten können. Das Zentrum verfügt über eine Notaufnahme/Schockbehandlung, einen Operationsraum, ein klinisch-chemisches Labor mit Registratur, einen Raum für Sanitätsmaterial bzw. -versorgung, einen Pflege- sowie einen Intensivpflegebereich. Die 42-köpfige Besatzung, bestehend aus sechs Ärztinnen und Ärzten, sowie zahlreichen Pflegekräften, Notfallsanitäterinnen/-sanitätern und Medizinischen Fachangestellten, ist zu notfallchirurgischen Eingriffen in der Lage und hat eine begrenzte Fähigkeit zur stationären Patientenversorgung.
Ein Miniaturmodell eines mobilen Einsatzlazaretts mit 144 Betten zeigt die nächste Etappe der Rettungskette. Der Transport und Aufbau der etwa 150 Container dieses mobilen Krankenhauses mit Fähigkeiten zur multidisziplinären Diagnostik und Therapie dauere in der Regel zwei Wochen, schildert Most.
Zivile Partner und Versorgungslücken
Die finale Rückführung großer Mengen Verwundeter ins Heimatland über Zug, Bus oder Flugzeug ist für Deutschland noch Theorie. Ein symbolisch aufgestellter Bahnwaggon, in den zivile Helfende von Technischem Hilfswerk und Rotem Kreuz „Verwundete“ einladen, erinnert ironischerweise daran, dass die Bundeswehr seit dem Ende des Kalten Krieges über keine Schienenkapazitäten mehr verfügt. Und: Gerade bei der Integration militärischer und ziviler Rettungsstrukturen gebe es noch Herausforderungen, erläutert mir Generaloberstabsarzt Hoffmann: „Das sind zwei unterschiedliche Systeme. Unser Sanitätsdienst der Bundeswehr und zivile Versorgungsstrukturen folgen teils anderen Abläufen, Zuständigkeiten und Rechtsgrundlagen“. Seine Forderung: „Besonders in Krisenlagen braucht es klare Schnittstellen, abgestimmte Verfahren und dazu gemeinsame Übungen, damit im Kriegsfall, von der Alarmierung bis hin zur Krankenhausaufnahme, alles reibungslos funktioniert. Dabei wird es auch auf eine belastbare Versorgung mit Medizinprodukten aller Art ankommen“.
Im Lagezentrum der Übung wird das Dilemma für mich greifbar. Neben der Drohne „Grille“ präsentiert die Bundeswehr dort auch sprachgesteuerte Dokumentationstools und moderne Prothesen für kriegsversehrte Soldaten. Doch ein Sanitätsoffizier, der anonym bleiben möchte, warnt: Die Produktionskapazität für Hand- und Beinprothesen reiche nicht aus, um im Falle eines bewaffneten Konflikts an der NATO-Ostflanke täglich 1.000 Verwundete in Deutschland angemessen zu versorgen. Ohne Nachsorge drohten den Betroffenen schwerwiegende Folgeschäden – von Muskelabbau bis zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Depressionen.

Blick ins Innenleben eines mobilen Rettungszentrums der Bundeswehr.
Fazit
Die ILÜ San in Feldkirchen zeigt eindrucksvoll: Die sanitätsdienstliche Versorgung der Bundeswehr kann auf moderne Technik und entschlossene Einsatzkräfte bauen. Doch ohne integrierte Strukturen, eine resiliente Logistik und krisenfeste Lieferketten bleibt das System verwundbar. Im Ernstfall entscheidet nicht allein der Grad der Verwundung über Leben und Tod – sondern, wie gut vorbereitet das gesamte Netz aus Militär und Zivilgesellschaft wirklich ist.
Florian Wagle (BLÄK)
„Im Kriegsfall zählt Resilienz“
Kurz-Interview mit Generaloberstabsarzt Dr. Ralf Hoffmann
Als Befehlshaber des Zentralen Sanitätsdienstes der Bundeswehr ist Generaloberstabsarzt Dr. Ralf Hoffmann für die medizinische Einsatzbereitschaft der deutschen Streitkräfte verantwortlich. Im Interview mit dem „Bayerischen Ärzteblatt“ gibt er Einblicke in die strategische Bedeutung des Themas Patiententransport, beschreibt strukturelle Anpassungen im Sanitätsdienst der Bundeswehr und skizziert Wege zu einer widerstandsfähigeren Gesundheitsversorgung im Falle von Krisen oder Konflikten.

Generaloberstabsarzt Dr. Ralf Hoffmann (Bildmitte) ist auch Wehrmedizinischer Berater des Bundesministers der Verteidigung, Boris Pistorius (SPD), und Stellvertreter des Befehlshabers Unterstützungskommando der Bundeswehr.
Das diesjährige Kernthema der Informations- und Lehrübung des Sanitätsdienstes der Bundeswehr (ILÜ San) Anfang Juli in Feldkirchen war der Patiententransport in das Heimatland und die Versorgung durch nationale Blaulichtorganisationen. Warum wurde dieses Thema gewählt?
Hoffmann: Gesamtverteidigung besteht aus militärischer und ziviler Verteidigung, wobei es Schnittstellen gibt, vor allem im Bereich der zivilen Verteidigung und der Unterstützung der Streitkräfte. Eine enge Zusammenarbeit mit zivilen Blaulichtorganisationen und anderen zivilen Akteuren des Gesundheitswesens ist im Kriegsfall von zentraler Bedeutung. Deshalb zeigen wir in diesem Jahr bewusst deren Rolle und Einbindung in die sanitätsdienstliche Versorgung – vom Einsatzraum bis in die Heimat. Nur so lassen sich Schnittstellen realistisch bewerten und die Versorgungskette ganzheitlich betrachten.
Die Bundeswehr hat sich auch aufgrund neuer Bedrohungsszenarien im Rahmen der „Zeitenwende“ neu ausgerichtet. Welche Auswirkungen hat das auf den Sanitätsdienst?
Hoffmann: Die Bundeswehr passt sich den aktuellen sicherheitspolitischen Entwicklungen und den neuen Herausforderungen moderner Kriegsführung an. Für die sanitätsdienstliche Versorgung bedeutet dies konkret: Wir müssen durchhaltefähig, hochmobil und geschützt sein, um der Truppe in jedem Gefechtsszenario folgen zu können. Deshalb richten wir unsere Strukturen, unsere Ausbildung und unser Material konsequent auf die Anforderungen der Landes- und Bündnisverteidigung aus. – dazu gehört auch das Erforschen und Nutzen neuer Innovationen – gerade im Bereich der Informations- und Cybertechnologie.
Welche medizinischen Fähigkeiten hat die Bundeswehr in den vergangenen Jahren neu aufgebaut, und welche sind heute besonders gefragt?
Hoffmann: Aus den Erfahrungen des Ukrainekrieges haben wir viel für unsere Fähigkeiten und unsere Neuausrichtung lernen können. Gerade mit Blick auf die taktische Medizin und Notfallmedizin haben wir die Behandlung auf dem Gefechtsfeld angepasst. Dabei geht es nicht darum, taktische Handlungsweisen der ukrainischen Streitkräfte zu kopieren, sondern Einsatzgrundsätze zu entwickeln, die uns eine lageangepasste Versorgung von Verwundeten auch im intensiven Gefecht ermöglichen, ohne die Beweglichkeit unserer Kräfte zu hemmen. Von neuen Kompetenzen bis hin zu modularen Behandlungseinrichtungen und dem Einsatz von Drohnen sind wir dabei, uns umfassend auf neue Bedrohungslagen auszurichten.
Gibt es aus Ihrer Sicht bei der Gesundheitsversorgung im Krisen- oder Kriegsfall noch Luft nach oben?
Hoffmann: Definitiv – es gibt immer Verbesserungspotenzial. Im Krisen- und Kriegsfall zählt Resilienz, also robustere Strukturen, ein funktionierendes Miteinander und klare Führungs- und Kommunikationswege. Die Gesundheitsversorgung als gesamtstaatliche Aufgabe gilt es auch gesamtstaatlich krisenfest zu machen. Hierzu wollen wir unsere Zusammenarbeit mit Bund und Ländern, Klinikverbünden und den Blaulichtorganisationen weiter ausbauen und verbessern.
Vielen Dank für das Gespräch.
Die Fragen stellte
Florian Wagle (BLÄK)
Teilen:
Das könnte Sie auch interessieren: